Die Wurzeln
Siersleben im Mansfelder Land 1944: Im vorletzten Jahr des Großen Wahnsinns rang ich mich notgedrungen dazu durch, meine beengten Verhältnisse aufzuweiten und die Welt kennenzulernen, welches ‑soweit mich die Erinnerung an die mütterliche Auskunft nicht trügt- »so um dreivertel elewe« geschah. Obwohl ich einen Bruder hatte, wuchs ich als Einzelkind auf, denn mein Bruder Werner kämpfte sich bereits 14 Jahre früher in diese Welt und die er nach 69 Jahren schon wieder verließ. Beinahe hätte ich auch noch eine ältere Schwester besessen, wenn sie nicht bereits wenige Wochen nach ihrer Geburt wieder verstorben wäre.
Vater, ein gebürtiger Siersleber, also ä ächder Mansfäller, war Bergmann im Mansfelder Kupfer, genau wie sein Vater, und wiederum dessen Vater und auch dessen Vater …
Mutter-ebenfalls aine ächde Mansfällern aus Oberrißdorf- war, wie damals üblich, Hausfrau und sorgte dafür, daß um drei Uhr nachmittags das Essen auf dem Tisch stand; so war es Sitte, so war es üblich, so war es Recht. Vater kam dann von der Schicht, die früh um Sechs begonnen hatte. Dazwischen lagen acht Stunden harter Arbeit: In einigen hundert Metern ^^ Tiefe und in nahezu absoluter Dunkelheit, bei Temperaturen um 30 Grad, knieend, hockend, liegend auf scharfkantigem Gestein, schweiß- und tropfwassernaß, feinpulvrigen Gesteinsstaub einatmend rammte er in einem 80 Zentimeter hohen Streb einen ohrenbetäubenden Preßlufthammer in den Berg, um das nur einen Zentimeter starke Kupferflöz freizulegen.
Wenn Vater von der Schicht kam, war meine erste Frage immer die nach Hasenbrot. Ich weiß nicht weshalb, aber auf eine wieder mit zurückgebrachte Speck- oder Wurstbemme war ich richtig gierig
Uns Bergarbeiterkindern war beizeiten bewußt, welche Schinderei hinter einem Stückchen Gubber (Kupfer) steckte. 1989, als die DDR zusammenbrach, brauchte es geraume Zeit, zu realisieren, daß in jedem Baumarkt Kupfer-Halbzeuge tonnenweise zum Verkauf standen die man für solche unwichtige Dinge wie Dachrinnen oder Fensterbleche mißbrauchte.
Vater begann diese Fron, wie die überwiegende Mehrheit der Mansfelder, im Alter von vierzehn Jahren als Treckejunge mit noch härterer Arbeit: Es galt, die mit Kupferschiefer gefüllten und an einem Fuß befestigten Hunte, liegend und sich mit einer Hand gegen die Firste abstützend, im Streb nach vorn, zur Fahrt, zu schleppen, wo sie in Förderwagen umgeladen wurden.
Nicht ohne Grund konnte ein Bergmann mit Fünfzig in Rente gehen und nicht wenige Bergleute überlebten den frühen Rentenbeginn nur um wenige Jahre; Silikose (iche hawwes uff dr Plauze) gehörte irgendwie zum Leben eines Bergmannes dazu. Mein Vater hatte ein wenig mehr Glück; er fuhr erst am Pfingstsonnabend 1972 zum letzten Mal nach untertage. Verkehrsunfall.
In den frühen Jahren der DDR bekamen die Bergleute für diese Schinderei ‑im Mansfelder Sprachgebrauch: Gläche- mit etwa 800 Mark allerdings sehr viel Geld; das Gehalt meiner Schullehrer lag zwischen 250 und 350 Mark und ein Altersrentner, der keine Knappschafts-Rente bezog, mußte mit etwa 60 Mark auskommen. Im Monat.
Beide Großväter väterlicher- und mütterlicherseits waren ebenfalls Bärgkmänner, die noch mit der Keilhaue dem Kupfer zu Leibe rückten. Mutters Vater (er hatte Vorfahren im Hederslebener Bürgermeisteramt) arbeitete nach seinem Eintritt in das Bergmann-Rentnerleben als einfacher Landarbeiter auf dem Hof seiner Schwägerin ‑sie hatte einen Thondorfer Bauern geheiratet- für einen Hungerlohn als Knecht. Sein Leben lang, bis zu seinem Tod 1960, war er ein Verehrer der Monarchie und nannte WilhelmII. nie anders als Seine Majestät und brachte bei Gelegenheit auch schon mal ein Prosit auf ihn aus.
Während ich die Großeltern mütterlicherseits sehr gut erinnere, habe ich an meine Vater-Eltern keinerlei Erinnerung, wozu die Tatsache, daß sie bereits vor Erreichung meines ersten Lebensjahres verstarben, nicht unwesentlich beitrug.
Beide Großväter väterlicher- und mütterlicherseits waren ebenfalls Bärgkmänner, die noch mit der Keilhaue dem Kupfer zu Leibe rückten. Mutters Vater (er hatte Vorfahren im Hederslebener Bürgermeisteramt) arbeitete nach seinem Eintritt in das Bergmann-Rentnerleben als einfacher Landarbeiter auf dem Hof seiner Schwägerin ‑sie hatte einen Thondorfer Bauern geheiratet- für einen Hungerlohn als Knecht. Sein Leben lang, bis zu seinem Tod 1960, war er ein Verehrer der Monarchie und nannte Wilhelm II. nie anders als Seine Majestät und brachte bei Gelegenheit auch schon mal ein Prosit auf ihn aus. Während ich die Großeltern mütterlicherseits sehr gut erinnere, habe ich an meine Vater-Eltern keinerlei Erinnerung, wozu die Tatsache, daß sie bereits vor Erreichung meines ersten Lebensjahres verstarben, nicht unwesentlich beitrug.
Erste Erinnerungen
Aufgeregt rutsche ich auf dem Beifahrersitz eines Lastwagens hin und her, welcher im Schrittempo über das Kopfsteinpflaster holpert. Ich winke heftig aus dem Fenster meiner draußen neben dem Wagen herlaufenden und zurückwinkenden Mutter zu. Diese erste Autofahrt meines Lebens erstreckte sich über höchstens 100 Meter und endete an der Gaststätte Heklau, in deren Obergeschoß sich das Kino Sierslebens befand. Wer der Fahrer des Lastwagens war und warum es überhaupt möglich war mitzufahren, weiß ich nicht mehr. Dies ist meine früheste Erinnerung; so an die drei Jahre war ich.
Eine weitere sehr frühe Erinnerung betrifft einen blau-grauen, bedruckten Kinder-Tragemantel mit einer hell gesäumten Kapuze. Dieser Kindermantel war um die Schultern meiner Mutter geschlungen und hüllte uns beide ‑Mutter und mich- gleichermaßen ein. Entlang der Säume war er mit hellen Rüschen besetzt. Ich sehe, wie Sie mich im Arm tragend, auf der Thondorfer Straße steht, die auf einer Straßenseite stückweise fetten Grasbewuchs aufwies, und mir kleine gelbe Federbüschel zeigt, die durch das Gras torkeln – Hühnerküken.
Wie man sich bettet…
Mein Bett stand direkt unter dem Dach unseres kleinen Hauses. Lediglich eine dünne, graublau gestrichene Schalung war auf die Dachsparren genagelt und trennte mich von den kalten Biberschwänzen. Eine Isolation mit Dämmstoffen und Dampfsperren, wie es heute Standard ist, war damals völlig unbekannt. Deshalb war es im Winter innen fast so kalt wie draußen. Der Atemhauch schlug sich als kalter Reif auf der Bettdecke nieder, war unangenehm an Kinn und Hals und war so normal, wie die dicken Eisblumen am einfach verglasten Fenster der Bodenkammer. »K(g)äätzte« es draußen, lag morgens sogar überall im Bodenraum Flugschnee, der auch durch die kleinsten Ritzen seinen Weg ins Innere fand. Verschwand ich winterabends ins Bett, hatte Mutter mit einem heißen Ziegelstein dasselbe im Fußbereich schon etwas vorgewärmt. Für jedes Familienmitglied lag ein Klinker ‑also insgesamt vier- in der Bratröhre der Kochmaschine.
Wenn ich unserer Katze habhaft werden konnte, versuchte ich sie zu überzeugen, mich zu wärmen; deren Verlangen danach war aber nicht übermäßig ausgeprägt.
In meinem Bett lag die übliche dreiteilige (plus Keilkissen) mit Seegras gefüllte Matratze. Die etwas bessere Qualität mit Roßhaarfüllung stand einem Bergmanns-Haushalt nicht zu, da mußte man schon Steiger sein. Oder Pastor. War man gar Obersteiger oder Arzt, dann durfte man sich auf Federkernmatratzen wiegen. Meine Großeltern mütterlicherseits und darüber hinraus sehr viele Bekannte, Nachbarn und Verwandte hatten in ihren Betten noch Strohsäcke. Diese wurden zweimal im Jahr frisch gestopft und waren dann beachtlich voluminös aufgeplustert.
Dieser Bodenraum enthielt noch eine Menge Kartons in denen sich einige Hundert Glückwunsch- und Ansichtskarten, mehrere Dutzend Blusen- und Matrosenkragen, Bonbongläser (bereits geleert), Streichhölzer und Kerzen (wurden sukzessive bereits im Haushalt verbraucht), Stapel von Papp-Wursttellern, je ein Senf- und Kaffespender und vieles mehr befanden. Das alles waren die Überreste von »Hulda Schneemann – Colonialwaaren«.
Kindergarten im Wirtshaus
Ja, das gab es: In dem nach dem Großen Krieg am Boden liegenden Deutschland konnte man ganztägig einen Kindergarten besuchen. Ein solcher war in Siersleben eingerichtet im Vereinszimmer der Wirtschaft »Zur Kugel«, in der die Wirtin Hermine das Sagen hatte.
Kein Mensch nannte das Wirtshaus bei seinem Namen; es hieß einfach nur »(bei) Hermine«. Hermine war eine spröde Frau, vor der ich immer ein wenig Angst verspürte. Sie hatte eine laute, angerauhte, die Mansfelder Mundart perfekt artikulierende Stimme. Ihrer Physiognomie nach, könnte sie von den Habsburgern abstammen; niemand aber hat je derart Unglaubliches vernommen…
Selbst Jahre später, als ich schon mein Bier allein trinken durfte und das auch hin und wieder bei Hermine tat, hatte ich immer noch ein wenig Angst vor ihr; brauchte ich natürlich nicht, weil ich mein Bier ja immer bezahlte.
Also, im größeren der Vereinszimmer ihrer Wirtschaft spielten wir bei weniger schönem Wetter mit unserem bescheidenen Spielzeug: Holzbauklötze und ‑autos, Kaufmannsladen mit bunt lackiertem Gipskuchen und Gipswürsten und neckischen kleinen Ausziehkästchen, Puppen mit seltsamen schlaffen und mit irgendwelchem weichen Zeug ausgestopften Körpern, flache, lackierte Holztiere mit Fußbrettchen, die man zu einem Bauernhof zusammenstellen konnte. Auch erinnere ich mich an gelochte Pappen, auf die man mit kleinen, verschiedenfarbigen Tonperlen bezaubernde Mustern legen konnte; damit spielten aber nur »de glaien Määchen« – nix für uns Jungs. Ebenso fällt mir beim Stichwort Spielzeug Flechtpapier ein, damit konnten (natürlich nur von’n Mächn) wunderhübsche, bunte Untersetzer papiergewebt werden.
Wenn das Wetter es zuließ, spielten wir im Freien. Dazu stand uns der ehemaligen Biergarten der Kugel zur Verfügung. Dort hatten wir eine große Rasenfläche und einen Sandkasten zum Spielen zur Verfügung. Ganze Tage verbrachten wir im Sandkasten, wechselten Bäumchen, ließen den Plumpsack umgehen und hatten fürchterliche Angst vorm Schwarzen Mann. Hatte jemand von uns Knirpsen Geburtstag, gab es immer als Standardgeschenk eine kleine Blechschippe, zwei oder drei Sandförmchen und ein kleines Sieb. Es waren schöne Dinge, die unser kleines Herz klopfen ließen und mit denen man auch mal einem anderen an den Kopf schlagen konnte.
Das kleinere Vereinszimmer, ein Nebenraum unseres Aufenthaltsraumes, diente als Schlafraum. Hier waren einfache, mit einem Strohgeflecht bespannte, Klapp-Pritschen aufgestellt. Auf diesen Pritschen hielten wir unseren Mittagsschlaf (den ich heutzutage meist heftig vermisse). Leider aber sind mir viele Namen derer, die auf nebenstehendem Bild zu sehen sind, nicht mehr gewärtig, sondern nur einige: Karin Kempa, Uschi Ozimek, Willi Sauer, Ernst Teuchner, Dietmar Mokros, Rainer Günther, Lilo Tischler, und Wilma Rückschloß. Vielleicht bekomme ich ja ein paar Hinweise.

Biomalz
Ob wir im Kindergarten regelmäßig Mittagessen bekamen, weiß ich nicht mehr; ich glaube eher nicht. Aber – es gab das gesunde Biomalz! Noch heute, nach 70 Jahren, bekomme ich Gänsehaut, wenn ich daran denke. Alle Kinder bekamen täglich ihren Löffel voller Gesundheit. Ich hatte jedesmal mit Ekel- und Würgeattacken zu kämpfen, allein, unseren Kindergärtnerinnen, die stets frisch gestärkte, weiße Schürze trugen, sahen das weniger eng und füllten uns ab – ob wir gesund sein wollten oder nicht.
Um ein Vielfaches schlimmer als die Biomalz-Quälerei waren die sanitären Verhältnisse in unserem Kindergarten. Wie zu dieser Zeit üblich, gab es fast ausschließlich Trockentoiletten, die, insbesondere im Sommer, fürchterlich stanken und unglaublich schmutzig waren. Wann hat man je davon gehört, daß es auf dem Dorf Toiletten mit Wasserspülung giebt? – na also! Fließendes Wasser zum Waschen unserer Patschhändchen gab es nur aus einer normalen Pumpe, die auf dem Hof von Hermine stand.
Aber wir spielten natürlich nicht nur im Garten, manchmal unternahmen wir kleine Wanderungen, den kurzen Beinchen angemessen. Mehrere Male besuchten wir dabei auch Hornemanns Bockwindmühle. Es knarrte und ächzte immer bedrohlich, wenn sie von ihm in den Wind gedreht wurde; ob Knarren und Ächzen von der Mühle oder vom alten Hornemann kamen, war nicht so genau auszumachen. Die Windmühle stand zwischen Hübitz und Siersleben. Der Weg dorthin führte über den Hübitzer Weg, vorbei an Erdmengers kleinem Schreibwarenladen und wenn man den Deiwelszwern hinter sich hatte, war man schon fast da.
War gerade Mahltag, betrachteten wir ehrfürchtig staunend die vorbeizischenden Mühlenflügel und wurden ermahnt, nur ja nicht zu dicht heranzutreten, damit wir nicht geköpft wurden. Mehr Vorsicht war damals nicht notwendig; Rechtsanwälte wären verhungert.
Blumenfest in Clausings Garten
Eine weitere Erinnerung betrifft ein sogenanntes Blumenfest. Unsere “Tanten” hatten für jeden ihrer Schützlinge ein kleines Hütchen aus Papier gebastelt und ‑bis auf eines- mit Tusche bunt bemalt. Neben dem Hütchen hatten sie noch an einen kleinen Stock einen Blumenstrauß gebunden und jedes Kind durfte sich Hut und Blumenstock selbst aussuchen. An diesem Morgen kam ich verspätet in den Kindergarten; alle Kinder schnatterten unter ihren Hütchen hervor und freuten sich. Die Hüte waren also bereits verteilt und auf dem breiten Fensterbrett lag nur noch einer – der weiß-graue, der unbemalte Hut. Den Tränen nahe setze ich ihn auf meinen Kopf. Die mit einem Bleistift aufgezeichneten, sich kreuzenden zwei Linien waren wenig geeignet, den Hut schön zu finden; wenigstens das Blumenstöckchen aber war bunt.
Derart ausgestattet wanderten wir singend in einer kleinen Prozession die Hauptstraße entlang bis zur Dorflinde und die Mittelstraße hinunter zu Clausings Cafe. Die dazugehörende Bäckerei, war mit einer Schankerlaubnis ausgestattet, so daß alle Bäckermeister gleichzeitig Wirte waren. Hinter Clausings Wirtschaftsbäckerei lag ein Biergarten mit unbequemen Klapp-Gartenstühlen und ebensolchen Tischen. Wir häpelten aufgeregt auf die Stühle und harrten rotohrig der Dinge, die da vielleicht kommen. Und sie kamen – in Form von gläsernen Eisbechern, in denen herrlich bunte Eiskugeln leuchteten. So kam ich ‑und mit mir wahrscheinlich auch alle anderen Zwerge- zur ersten Eisportion unseres Lebens.
Ein Kinderfaschings-Tag ist ebenfalls in meinem Gedächtnis hängen geblieben, bei dem ich, einem Vorschlag meiner Mutter folgend, einen Bauern gab: ”Wenn Du als Bauer gehst, brauchst Du kein Kostüm und ich habe keine Arbeit damit” (Wen’de als Bauer jehst, brauachsde kaij Gostim un ich hawwe kaijne Arwait:«. Das leuchtet heute ein.
Ohne Tiere allerdings gibt ein Bauer nicht allzu viel her (heute ist das anders – Bauer hat Windmühle), also beschloss meine Mutter, daß mein Holzferd mitzunehmen nicht falsch sein könne. Die Beine des Pferdes waren in einem Brett ‑welches auf Rädern lief- festgeleimt. Insgesamt errichte es damit eine Höhe, von etwa 60 Zentimetern, gerade richtig für einen Vierjährigen. Ich zog, schleppte und schob meinen Gaul zum Kindergarten, wo er von fast allen Spielkameraden behoppelt wurde, welches allerdings nur begrenzt mein Wohlwollen fand. Am Nachmittag war Schluß mit Fasching, mit Pfannkuchen essen und Brause trinken und damit war auch mein Bauern-Dasein zu Ende. Missmutig schob ich mein Pferd nach Hause. Der Zügel aus dünnem Kunstleder war zerrissen, der lange Schweif rutschte immer wieder aus seinem Loch, ein Steigbügelriemen war ebenfalls gerissen, die steifen Pferdeohren waren zerknittert, alle in das Brett eingeleimten Beine hatten sich gelöst und wackelten. Also – unterm Strich war die Bauern-Idee meiner Psyche wenig zuträglich.
Kleine Friedenskämpfer
So klein wir waren, zum Friedenskampf reichte es allemal. Damals fing die sozialistische Indoktrination so langsam an Breite zu gewinnen; die Welt wurde schwarz-weiß: Amerika – böse, Sowjetunion – gut.
Wir waren fröhlich, als man uns erklärte, daß Friedenskämpfer jetzt eine DDR gegründet hätten und wir sie gegen Böse schützen müssen – das ganze Repertoire, das mich 40 Jahre lang begleitete. Niemand konnte sich vorstellen, was oder wer das sei: DDR – Na, ein Staat, ein Land, unser Land. Und wir müssen unser Land verteidigen- was ist verteidigen? Wo verteidigen? Jetzt gleich? Auch im Dunklen? – Alles viel zu abstrakt für Vierjährige.
Wir riefen im Chor »Ami Go Home« und »Nieder mit Adenauer« und »Wir wollen Frieden auf lange Dauer – Darum weg mit Strauß und Adenauer!«. Wenn wir das nämlich im Chor rufen, gehen die bösen Amis vor Schreck nach Hause. Sie rennen davon – aus Westdeutschland genauso wie aus Korea. Was ist denn Korea? Ist Korea Westdeutschland? Mein Gott, wir waren überhaupt nicht in der Lage die Bedeutung solcher Berieselung zu erfassern. Wir kannten kein Korea – und Amis kannten wir nur aus Erzählungen, in denen sie besser wegkamen, als man uns versuchte beizubringen. Die Erwachsenen wußten, wovon sie sprachen, konnten sie doch das Auftreten beider Besatzungsmächte unmittelbar vergleichen, denn zunächst besetzten nach Kriegsende die Amerikaner für einige Monate unsere Region, um sie dann ‑im Rahmen des Potsdamer Abkommens- an die Russen zu übergeben.
Wir sangen aber nicht nur Ami Go Home, sondern auch nach der Melodie eines damals aktuellen Schlagers, den Bully Bulan ‑so glaube ich- sang »Chia chia cho – Käse jiwwets im HO – Fische jiwwets an der Grenze – wenn de drahn kämmst jibt es nur noch Schwänze …« Hhmm
Nicht für die Schule lernten wir
Stolz: Der Erster Schultag
Hellblau die Tüte, golden die Spitze, rosa der Krepp-Papier-Verschluß: Das war meine Zuckertüte. Weiß das Hemd, weiß die Kniestrümpfe und dunkelblau die kurze Hose: Das war ich. Beides zusammen das war mein erster Schultag am 1. September 1951.
Das ganzjährige Tragen kurzer Hosen bis zur Konfirmation durch uns Jungen war die Regel. Im Winterhalbjahr trug man die äußerst lächerlichen langen, braunen, maschinengewirkten Strümpfe, die von einem Leibchen gehalten wurden. Einem Leibchen! Meines war aus hellblauer Wolle gehäkelt und vorn mit mehreren Wäscheknöpfen zu schließen. Vom Leibchen baumelten vier gelochte Gummibänder mit einer Art Spange am Ende, in welche die Strumpfränder geknöpft wurden.
War es richtig kalt, hatten alle Kinder zwischen Leibchen und Strumpf blaugefrorene Haut, denn eines war immer zu kurz – Strümpfe oder Hose. Ließ die Witterung es zu, rollten wir die Strümpfe nach unten; mit den dicken braunen Strickwürsten um unsere dünnen Knöchelchen sahen wir sehr schick aus (60 Jahre später kupferte Whitney Houston dieses Styling für sich selbst ab, siehe voriges Bild). Im Sommerhalbjahr wurden die langen Strümpfe gegen Kniestrümpfe getauscht, die allerdings nur sonn- und feiertags getragen wurden. Den Sommer über liefen wir ohne Strümpfe und auch ohne Schuhe; barwes Laafen nannte man das.
Die Einschulungsfeier fand im Tanzsaal bei Hermine statt. Die Festrede hielt der Herr Direktor G., der nach einem Jahr in westlicher Richtung verschwand oder verschwinden mußte – ich weiß es nicht. Mein erster Klassenraum befand sich in der Alten Schule (heute gehört das Gebäude einem meiner besten Schulfreunde) in der ‑na, klar- Schul- / Ecke Teichstraße. Den ersten Eindruck beim Betreten habe ich nicht vergessen, das war dieser typische Schulgeruch. Das Klsssenzimmer besaß Holzdielen, die mit einem intensiv riechenden Fußbodenöl getränkt wurden, welches zugleich dem Fußboden eine schmutzig-schwarz-braune Farbe mit dem optischen Eindruck von Nässe verlieh; ich sehe noch das Warnschild ”Vorsicht! Frisch geölt!” über mir.
Im Klassenraum standen zwei Bankreihen, wohl noch aus Kaisers Zeiten. In den zwanziger Jahren, hatten in Ihnen bereits unsere Eltern gesessen. Sitzbank und Schreibfläche waren miteinander verbunden und boten Platz für drei Schüler. An jedem Platz befand sich eine ausgefräste Nut als Ablage für das Schreibgerät und ein in die Bank eingelassenes Glasfäßchen für Tinte.
Als einmal das Brennmaterial für den an der Wand stehenden, wuchtigen gußeisernen Ofen auszugehen drohte, wurden die Schüler gebeten, nächstentags ‑wenn möglich- ein Brikett mitzubringen; bei etwa 25 Schülern konnte damit den ganzen Tag geheizt werden.
Die Schultafel ruhte auf einem Gestell und konnte durch Umklappen gewendet werden und war eine vergrößerte Ausfertigung unserer Schiefertafel – auf der Vorderseite Schreiblinien und rückwärtig Rechenkästchen – meinetwegen auch umgekehrt.
Die meisten Kinder besaßen einen richtigen Schulranzen, wenngleich er selten ladenneu war. Im ersten Schuljahr hatte der Ranzen nur wenig Utensilien zu fassen: Die Schiefertafel, den mit einem Bindfaden an derselben befestigte Schwamm und den Schieferkasten, der in drei Fächern Schiefergriffel, Federhalter und Federn aufnahm – Letztere wurden allerdings im ersten Schulhalbjahr noch nicht benutzt. Mei’ Schewwergasdn war aus lindgrün lackiertem Holz mit bunten Blümchen auf dem Schiebedeckel. Manchmal geschah es, daß beim allmorgendlichen Vorzeigen der Hausaufgaben die Tafel durch den Inhalt des Ranzens unabsichtlich gelöscht war. Unsere Lehrerin tat dann so, als ob sie uns das glaube.
Schlagkräftig: Erziehungshilfen
Bereits in der ersten Klasse gab ich öfters mal den Klassenkasper, was dazu führte, daß ich schon nach wenigen Schultagen meine erste Ohrfeige von unserer Klassenlehrerin Fräulein K. einsteckte.
Ein anderer Lehrer, Herr x., nahm, bevor er schlagende Argumente zu gebrauchen dachte, seine Uhr vom Arm, legte sie sorgfältig auf dem Tisch ab, nannte dann den Namen des Delinquenten, befahl ihn nach vorn, belehrte in handgreiflich, band sich die Uhr wieder um und setzte seinen Unterricht fort, als wäre nichts geschehen.
Rechtes Bild (von links):
Hintere Reihe: Rose, Helmut; Cechini, Walther; Mau, Werner; Schuchert, Herbert; Ringleb, Manfred; Reinhardt, Karl; Unterschütz, Johannes; Brehmer, Helmut; Mann, Gerhard; Köppe, Otto.
Vordere Reihe: Schwanemann, Heinz; Klos, Kurt; Müller, Christa; Eisenblätter, Liersbeth; Meißner, Georg; Rudat Ursula; Heinrich, Harald.
Ein weiterer Lehrer hatte die Angewohnheit, ertappte oder aufgefallene Schüler ‑aber ausschließlich Jungen- an den Ohren aus der Bank hoch und immer höher zu ziehen. Manchmal prüfte er auch die Reißfestigkeit der Wangen, indem er hinein kniff und dann die Hautfalte drehte. Beides waren gefürchtete, weil schmerzhafte Erziehungsmethoden.
Was gab es noch für Erziehungshilfsmittel? Das waren Streiche mit Geigenbogen, Lineal, Schul- oder Klassenbuch, Zeigestock und andere Gegenstände des täglichen Lehrerbedarfs – wie Schwamm und Kreide. Kleinere Hiebe, etwa auf den Hinterkopf (»Schwatz nicht«) so im Vorbeigehen, waren für uns absolut normal. Es war ja nicht so, daß man eine Kopfnuß einfach ohne jeden Grund bekam – es war lediglich ein Hinweis auf ein Fehlverhalten. Man spürte, daß man sich nicht regelgerecht verhalten hatte und lernte daraus. Offiziell war Züchtigen zwar verboten, doch niemand wagte es, zu Hause bei den Eltern Beschwerde zu führen. Bestenfalls gab es von ihnen zustimmende Kommentare; schlimmstenfalls noch eine weitere Ohrfeige obendrein.
Kein Lehrer wurde wegen Körperverletzung angezeigt und kein Schüler fühlte sich in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt. Kein Schüler wurde gefragt, ob heute denn Unterricht stattfinden solle oder ob man doch lieber die Integration der Umsiedler in die Dorfgemeinschaft nun endlich einmal ausdiskutieren wolle. In der Schule lernten wir, dazu war sie da. Niemand wäre auf eine so absurde Idee gekommen, Fächer abzuwählen. Wenn auf dem Stundenplan Mathematik stand, dann wurde gerechnet und der Lehrer diktierte etwa: ”Ein Bauer verkauft einen Doppelzentner Kartoffeln für 10 Mark. Wieviel verdient er, wenn er 25 Doppelzentner verkauft und die Kosten für Anbau und Ernte 0,80 Mark je Zentner betrugen?”
Dann wurde geschaut, wie die Aufgabe aufbereitet wurde, d.h. es wurden alle Zahlen und Werte in ”gegeben” und ”gesucht” unterteilt, wie wurde die Lösung vorbereitet, welcher Rechenweg wurde eingeschlagen und stimmt das Ergenbis numerisch. Dafür gab es Punkte und anhand der Punkte gab es Noten. Basta. Entweder verstand man die Aufgabe, dann konnte man sie rechnen oder eben nicht. Es gab keine Rechen‑, Lese‑, Rechtschreib- und andere Schwächen. Obige Aufgabe in das heutige Schulsystem transponiert könnte vielleicht so lauten:
Ein Öko-Agrarwirt erzielt auf dem freien Markt für 100 kg Bio-Kartoffeln einen Umsatz von 100 Euro. Verkauft er 2500 kg, erhöht sich sein Erlös auf 2500 Euro. Die Erzeugerkosten für nachhaltigen ökologischen Anbau und umweltfreundliche und nachhaltige Ernte betrugen insgesamt 500 Euro, so daß sein Gewinn vor Steuern 2000 Euro beträgt. Vollziehe dieses Beispiel marktwirtschaftlicher Gegebenheiten in Gedanken nach, unterstreiche das Wort Kartoffel mit einem naturbelassenen Bleisift, diskutiere über das Ergebnis und demonstriere anschließend gegen die Umweltzerstörung durch Nitrate.
Meine Schulleistungen waren immer Mittelmaß. Ich lernte niemals in dem Sinne, daß ich ein Lehrbuch aufschlug und versuchte, mir den Stoff einzuprägen. Auch später in der Lehre und während des Studiums tat ich das nicht. Den während der Unterrichtsstunden gebotenen Stoff nahm ich auf oder auch nicht. Fertig. Irgendwie funktionierte das ganz gut und der Energieaufwand für das Lernen minimierte sich. Kurz bevor eine Klassenarbeit oder Klausur geschrieben wurde, gab es immer hitzige Diskussionen mit hochroten Köpfen und schlotternden Gliedern; fast Jeder machte Jeden verrückt. Da wurden hastig neue Spickzettel geschrieben oder bestehende abgeändert, da wurden Kommunikations-Codes abgesprochen und gleich falsch verstanden … Niemals beteiligte ich mich an diesen hektischen Vorbereitungen, sondern wartete ruhig und gefaßt einfach darauf, daß es losging. Nicht selten auch nach hinten.
Unverzichtbar: Neulehrer
Lehrer wurden von der Dorfgemeinschaft eingestuft als Studierte einerseits und Neulehrer andererseits. Letztere wurden in der Nachkriegszeit in Schnellkursen an der Arbeiter- und Bauern-Fakultät (ABF) ausgebildet und waren nicht zwangsläufig die schlechteren Wissensvermittler, wie es manche Alte des Dorfes glaubten. Die Neulehrer in der frühen DDR ersetzten NS-belastete Pädagogen, die in der Regel aus dem Schuldienst erntfernt worden waren. Und wir Schüler unterschieden sowieso nicht nach diesem Kriterium. Ob studiert oder Neu – bei uns waren eigentlich alle beliebt. Wir teilten sie lediglich in die Kategorien »gut« und »streng« ein, basta.
Ein von allen respektierter Lehrer, ehemals Major der Wehrmacht und bei der Entnazifizierung den sogenannten Persilschein erhalten (er konnte anmutig den Bogen streichen und Handarbeit am Klavier vollbringen) lehrte uns Mathematik und Musik. Wenn er Pausenaufsicht hatte, ging es auf dem großen Pausenhof zu, wie im Kloster; jeder Verstoß gegen die Schulordnung endete mit rotgestreichelten Ohren oder Wangen. Auch das Hände-in-die-Hosentasche-stecken war gefährlich. Entdeckte er jemanden bei socher Lümmelei, bellte er, laut die Konsonanten spuckend, dessen Namen über den Schulhof. Er belehrte des Ertappten Ohren oder Wangen durch Zwicken und Ziehen, so daß dessen Hände automatisch aus den Taschen fuhren.
Selbst bei Frost, bei Wind und Wetter stand dieser Lehrer ohne Handschuhe wie eine Statue am Schulhoftor und beobachtete das Treiben. Er war ein guter Lehrer; wir verehrten ihn. Eines Tages, außerhalb der Schulzeit, gingen wir Jungen der Klasse in größeren Abständen ‑Einer wie zufällig hinter dem Anderen- in einer langen Reihe die Augsdorfer Straße entlang und grüßten ihn. So, wie wir beim Grüßen unsere Mützen abnahmen, lüftete auch er beim Gegengruß seinen Hut. Wie ein Grüß-August nahm er mehrere Male seinen Hut ab – und stutzte. Er bellte uns unterhalb der Kirche zu sich und ließ uns »in Linie« antreten. Wir fürchteten wieder einmal um Ohr und Wange – aber:
»Ihr kennt Das Köhlerliesel!?«
»Ja, Herr M.«
»Das weiß ich! – Jeder schreibt zehnmal den Text auf und morgen singt Ihr dieses Lied der Klasse vor!»
Schweigen…
»Ab!«.
Durch das West-Radio wußten wir, daß es ein Bill Heeli war, der Rockaraundseklack sang und dessen Sang uns ausnehmend wohl gefiel… Wir hörten einen Elbis Bresli und waren fasziniert. Und jetzt dies ‑Das Köhlerliesel …
Wir rebellierten, vorsichtshalber aber nur innerlich, und übten das Liesel-Lied ein wenig – oben, auf dem alten Kirchhof vor dem riesigen Wagner-Grabstein. Als Chorknaben standen wir in der nächsten Mathestunde vorn und sangen »Im Harz, da ist es wunderschön, da steht ein Köhlerhaus und morgens, wenn die Hähne kräh’n schaut’s Köhlerliesel raus… ». Die Mädchen wollten sich ausschütten vor Lachen – und sangen dann mit.
Ebenfalls Neulehrer war der Russisch-Lehrer Herr Ringleb (der noch 2019, rund 60 Jahre später an Klassentreffen seiner Schüler teilnahm) und der die schwierige Aufgabe hatte uns die Sprache der Besatzungsmacht beizubringen. Schwierig, schwierig: Die Sprache an sich, der ideologische Widerstand vieler Eltern (»Deutsch, richtig gesprochen, reicht!«) und die fehlende Bereitschaft vieler Schüler überhaupt eine Fremdsprache zu erlernen. Aber jeder ehemalige DDR-Schüler erinnert sich an Nina aus dem Einführungsgedicht im Russisch-Lehrbuch der 5. Klasse: Nina, Nina, tam kartina – eto traktor i motor. Russisch ist so einfach
Ungebraucht: Junge Pioniere
Obwohl das Tausendjährige Reich mit seinen Jugendorganisationen erst sechs Jahre zurück lag, waren alle unsere Eltern erstaunlich unkritisch, als es darum ging, Mitglied der Jungen Pioniere (und später auch der FDJ) zu werden. Jedenfalls wurden alle meine Klassenkameraden und ich nach der Einschulung stolze Pioniere, die man damals noch nicht nach Jung- und Thälmann-Pionieren unterschied. Wir bekamen einen Pionierausweis und gelobten, immer fleißig zu lernen, die Freundschaft zu allen Völkern der Sowjetunion zu pflegen und den Freund aller Pioniere, Arbeiter, Bauern usw., den großen Josef Wissarionowitsch Stalin, unerschütterlich zu lieben.
Stalin war in dieser Zeit zu allem zu gebrauchen, paßte immer und zu jeder Zeit, hatte in irgendeinem Buch alles bereits gewußt und vorhergesagt. Überall war er präsent: Auf Bildern, in Losungen und auf Transparenten. Seine Zitate (”Die Hitler kommen und gehen, das deutsche Volk bleibt bestehen”) waren überall angetackert. In Reden, in Liedern und Gedichten (”Im Kreml brennt noch Licht”), in Lese- und Geschichtsbüchern, in Filmen und Zeitungen. Alles war verstaliniert; immer und überall. Stalin wurde uns derart penetrant nahegebracht, daß sogar meine Mutter, die vollkommen unpolitisch und unaufgeregt ihre täglichen Aufgaben in Haus und Hof erledigte, mich eines Morgens mit den Worten ”Gomm, mei Horschdi, uffstehn – Stalin is heite Nacht jestorm” weckte, so, als wäre dieser der liebe Onkel von nebenan. In dieser Zeit äußerte man sich öffentlich sehr verhalten zu politischen Tagesfragen. Man hielt das Maul und machte das, was verlangt oder erwartet wurde. Je nach offizieller Erwartung wurden politische Aussagen unterstützt, gutgeheißen, bejubelt, verteufelt, verurteilt oder es wurde ”hoch hoch hoch gelebt”. Das war das Eine.
Das Andere war das Privatleben. Waren abends die Haustüren abgeschlossen und die Fensterläden vorgelegt, hörte man im Radio den NWDR, den Nordwestdeutschen Rundfunk (später sah man ihn auch), diskutierte hitzig die jüngsten Normerhöhungen uff’m Schacht und beklagte die elende Mangelversorgung.
Es war wie in einem Theater: Auf offener Bühne wurde ein Stück gemäß Libretto gepielt, der Regisseur stand in den Kulissen und der Soffleur gab die Stichworte. Fiel der Vorhang, waren alle Darsteller wieder privat und mußten sich um ihre täglichen Angelegenheiten kümmern. Und genau diese Stimmung war auch unter uns Schülern verbreitet: Im Staatsbürgerkunde-Unterricht diskutierten wir hitzig, referierten über den »Amiknecht« Adenauer und forderten ”Deutsche an einen Tisch”. Wir schrieben Aufsätze, warum die Genossenschafts- den Einzelbauern überlegen sind und weshalb Chemie Wohlstand, Schönheit und Brot bringt.
Per Vorgabe aus dem Souffleurkasten erklärten wir den technologischen Rückstand der DDR mit dem Vorhandensein von »nur drei Hochöfen« und wir rasselten herunter, weshalb der Wiederaufbau der Schwer- gegenüber der Leichtindustrie Vorrang hatte und tausend andere Sachen mehr.
Wir wußten, der Vorhang ist offen. Bei all dem Gerede von Ausbeutung und Kriegstreiberei, von Hetzsendern und Gehlen-Agenten wurde immer zwischen den Zeilen gelesen, war immer der Subtext des Gesagten präsent. Dieses Leben auf zwei Ebenen war jedem DDR-Bürger vertraut, ging ihm in Fleisch und Blut über und brachte uns alle letztendlich unbeschadet über die Jahre 1949 bis 1989.
Heute, im Juni des Jahre 2021, im Jahr 16 der Merkel-Kanzlerschaft erfahre ich ein Déjà-vu. DDR 2.0.
Ungewohnt: Kühe machen Mühe
Meine Klassenkameraden und ich absolvierten als erster Schülerjahrgang –ich denke, es war 1959- das neue Unterrichtsfach »Einführung in die sozialistische Produktion« – auch Polytechnischer Unterricht genannt.
Damals wurden DDR-weit die zehnklassigen Polytechnischen Oberschulen als einheitliche Regelschulen gegründet, so auch in Siersleben.
Unsere Klasse hatte diesen wöchentlichen Produktionstag ein Jahr lang auf dem Volksgut Hübitz (VG Hübitz) mit seinem Hof in Thondorf und ein Jahr in der Lehrwerkstatt des Thälmann-Schachtes zu absolvieren.
Die durchzuführenden Arbeiten waren zunächst zwar etwas ungewohnt, aber nicht schwierig. Es war nicht falsch, wenn man mit Feile, Bohrer und Hammer umzugehen lernte. Man bekam ein Gefühl dafür, wie es ist, wenn man in diese Art Arbeitswelt eingebunden ist, wenn man nur eine Frühstücks- und Mittagspause einlegen kann und ansonsten durcharbeitet; Schulstunden à 45 Minuten waren passè.
Auch die landwirtschaftlichen Arbeiten auf dem Gut machten richtiggehend Spaß – wenn man sich an den Geruch in den Schweine- und Rinderställen gewöhnt hatte. Wir lernten Kuh und Pferd zu striegeln, sie zu füttern und deren Hufe zu säubern und zu beurteilen, den Schweinestall mit einem Gülleschieber auszumisten und Futter zu verteilen. Wir versorgten die Schafherde im Winterstall mit Futter und kneteten die Hinterlassenschaft der Schafe zu einem Klumpen, um einzelne Tiere damit auf dem Rücken mit einem Strich zu kennzeichnen. So konnten sie später aussortiert werden.
Wir mischten Futter, lernten den Ablauf in der Zuckerfabrik Helmsdorf kennen und ließen uns erklären, wie Milch entsteht. Auch heute noch finde ich diese Art, Schüler an produktive Arbeit heranzuführen, sehr gut; man kann nicht meckern!
Ferienzeit – schönste Zeit
Sommerferienlager
Die unbestreitbaren Höhepunkte meiner Kindheit waren die Ferienlager, die eingerichtet, betrieben und finanziert wurden von den Volkseigenen Betrieben, in meinem Fall von den Betrieben des Mansfeld Kombinat Wilhelm Pieck. Sommers betrug die Verweildauer in den Lagern in zwei Durchgängen je drei Wochen, in den Winterferienlagern eine Woche. Als Unterkünfte dienten Wehrmachtszelte, Baracken, Strohböden einer LPG…
Das erste Ferienlager, an dem ich teilnahm, befand sich im Thüringer Holzland, in der Nähe des kleinen Dorfes Bollberg. Es war aufgebaut auf einer Wiese, die zwischen einer hoch auf einem Abhang führenden Straße und einem kleinen Fluß lag. Das Lager bestand aus etwa drei oder vier 10-Mann-Wehrmachtszelten, in denen je zehn Kinder und ihre Betreuer auf Strohsäcken schliefen. Wir waren aufgefordert, je zwei Wolldecken mitzubringen; eine, um den Strohsack abzudecken und die zweite um uns selbst zudecken zu können.
Ein solches Lager wurde geleitet von einem Lagerleiter, der sonst ein normaler Betriebsangestellter war und einem Wirtschaftsleiter, einem Angestellten der betrieblichen Buchhaltung. Unterstützt wurden diese beiden durch Betreuer, die je eine Gruppe bestehend aus etwa 10 Kindern betreuten. Die Betreuer waren meist junge Betriebesangehörige. Auch ein Sanitäter wurde vom Betrieb gestellt, während Köchinnen und Küchenhilfskräfte am Ort des Ferienlagers gewonnen wurden.
Der Tag im Ferienlager hatte immer noch (oder schon wieder) militärische Züge und begann mit einem Weckruf, geblasen auf einer Fanfare. Danach ging es zum immer unbeliebten Frühsport. Gewaschen wurde sich unter einer einfachen Kaltwasserleitung, die über großen Steinbottichen installiert war. Anschließend mußten die ”Betten gebaut” werden und dann ging es zum Frühstück, das aus einigen Scheiben Wurst, etwas Butter und viel Marmelade und / oder Kunsthonig bestand. Der Kunsthonig war unglaublich süß, hart und bröckelig; nur mit einer gewissen Kraftanstrengung war er aus filzigen, grauen Pappbechern bzw. ‑eimern zu lösen. Kunsthonig, Zuckerrübensirup und Biomalz sind für mich noch heute ‑nach 60 Jahren- ein Inbegriff des Schreckens. Zum Trinken gab es Früchtetee und Malzkaffee. Milch und Kakao wurden auch, aber nur begrenzt, gereicht. Nach dem Frühstück fand der obligatorische Fahnenappell statt (alle, die einige Jahre älter als wir waren, kannten diese Rituale noch aus HJ-Lagern…).
”Guten Morgen Kinder! - Seid bereit!”
”Immer bereit”
”Kinderferienlager – stillgestanden! … Fahne – hißt!”
Langsam stieg die Fahne am Mast empor. Dazu wurden jeden Tag zwei andere Kinder bestimmt – Eines das die Fahne nach oben zieht und das Zweite, aus dessen Händen die Fahne gezogen wird.
»Kinderferienlager – Rührt Euch!”
Dann wurden Dinge des täglichen Lagerlebens bekanntgegeben, welche Gruppe heute was tut, ob es ins Kino geht, eine Wanderung ansteht und solcherart Dinge. Es wurden auch ”Vokommnisse« ausgewerte” oder Geburtstagkindern öffentlich gratuliert. Auch wurde Kaltverpflegung für den Fall ausgegeben, daß eine Aktivität außerhalb des Lagers den Zeitpunkt des Mittagessens überschritt.
Diese Fahnenappelle gab es in jedem Sommer-Ferienlager; als Fahne wurde die des Weltbundes der Demokratischen Jugend verwendet.
Auch in unserer Siersleber Schule gab es montags immer einen Fahnenappell. Waren im Kalender Feiertage verzeichnet, wurde auch ein feierlicher Fahnenappell angeordnet; das bedeutete, man mußte mit Pioniertuch (halbfeierlich – z.B. Adolf Henneckes Geburtstag; Tag des Lehrers) oder in Pionierkleidung, also mit weißem Hemd mit Emblem, kurzer blauer Hose bzw. Rock und weißen Kniestrümpfen erscheinen (feierlich – z.B. Tag des Bergmanns; Thälmanns Geburtstag). Manchmal sang noch der Schulchor und wurden Gedichte rezitiert (ganz feierlich ‑z.B. Stalins Geburtstag; Tag der Republik).
In einem Fall ‑Stalins Tod- wurde zunächst ein improvisierter normaler Appell durchgeführt. Nach einer Woche aber, nachdem alles zentral organisiert war, waren über krächzende Lautsprecher dumpfe Trommelwirbel zu hören. Die schwarz geflorte rote Fahne mit den Werkzeugen wurde auf Halbmast gezogen, während je eine rote und schwarz-rot-goldene Fahne, von zwei auserwählten Schülern getragen, geneigt wurden. Ein Profisprecher vom Stadttheater Eisleben rezitierte mit übertriebenem Pathos und überflüssigem Vibrato ein Heldenepos. Anschließend gab es zwanzig Minuten lang noch eine Rede, ein paar Lieder, noch’n Gedicht und einen Trauermarsch auf die Pionier-Ohren (noch mehr als feierlich).
Typisch für solche Ferienlager war die Gründung von Arbeitsgemeinschaften. Es gab solche für fast alle Interessens- oder Wissensgebiete, beispielsweise ”Junge Sanitäter”, ”Junge Touristen”, »Junge Biologen”. Ich fand immer die Jungen Touristen sehr interessant. Man lernte Feuerstellen anzulegen, mit Karte und Kompass zu navigieren und ohne diese Hilfsmittel anhand von Merkmalen der Flora, einer Uhr sowie dem Sternenhimmel die Himmelsrichtungen oder Entfernungen zu ermitteln – alles Dinge, die vor uns Jungen Touristen bereits Millionen Wandervögel, Pfadfinder oder Pimpfe lernten.
Ein anderes Sommerferienlager wurde in dem kleinen Dorf Grebs in der Nähe Lehnins in Brandenburg ausgerichtet. Hier war mein Vater als Lagerleiter eingesetzt und so konnte ich (nicht ganz legal) beide Durchgänge, also sechs Wochen am Stück hier verleben. Untergebracht waren wir auf dem Heuboden der örtlichen LPG. Vater logierte während dieser Zeit auf einem Bauernhof. Zwischen der Familie des Bauern und der Unsrigen entwickelte sich eine langjährige Freundschaft.
Fast täglich konnte man im nahegelegenen Görnsee baden. Es gab die beliebten Nachtwanderungen und im Nachbardorf Netzen fanden Kinovorstellungen statt.
Der Glanzpunkt jedoch war der Aufbau eines kleinen Außenlagers mit Campingzelten mitten im Wald (streng nach Lehrbuch: Windrichtung beachten, Hügel suchen). Mittags mußte das Mittagessen (konfektionierte Erbswurst-Suppe) am offenen Feuer (streng nach Lehrbuch: Abstand zu Bäumen, Steinkreis, Funkenflug) selbst zubereitet werden. Dazu war Wasser zu suchen und abzukochen. Zum Abschluss ein Geländespiel, bei dem West-Agenten und Ami-Spione bis zum bitteren Ende gejagt und vernichtet wurden.
Abends am Lagerfeuer wurden mitgebrachte Fettbemmen gemampft und Lieder zur Gitarre gesungen: Spaniens Himmel, Bella ciao, Ich trage eine Fahne. War der Kampflieder-Block beendet kamen das Köhlerliesel, das Bauernhaus im Odenwald und das Alte Försterhaus zum Zuge. Nach der Übernachtung im Zelt wurde am nächsten Tag alles wieder abgebaut (streng nach Lehrbuch: Abfälle vergraben; Feuerstelle mit Sand abdecken) und in’s Basis-Lager zurück marschiert.
Noch Jahre später war ich als Camper (bitte im positiven Sinne) viele Wochenende mit Freunden, Zelt und Rad unterwegs. Campingplätze im heutigen Sinne gab es noch nicht. Entweder gab es Zusammenrottungen von Zeltfreunden, dann gesellte man sich einfach hinzu oder man schlug sein Zelt irgendwo auf. Wasser schöpfte man aus Bach oder Quelle. Lebensmittel wurden in einem Erdloch kühl gehalten. Benutztes Geschirr wurde mit Sand gesäubert und abgepült. Auf elektrisches Licht mußte man ebenso verzichten wie auf Toiletten und installierte Waschgelegenheiten. Abfälle gab es gut wie keine; alles war aus Papier oder Pappe. Zog man weiter, vergrub man die Abfälle. Fertig.
Was in allen Sommer-Ferienlagern zum Himmel stank, waren die sanitären Verhältnisse; weniger die Waschgelegenheiten als viel mehr die Toiletten. Das waren Trocken-Aborte, die einen wenig angenehmen Geruch in die heiße Sommerluft entließen. Um die Infektionsgefahr zu mindern, wurde abends großzügig eine dicke Schicht Chlorpulver über die Hinterlassenschaften gestreut; auf diese Weise hing stets ein typischer Geruch über den Lagern, so wie man es auch aus öffentlichen Bädern kennt.
Apropos Infektionsgefahr: Ich erinnere mich, daß 1964 zur Eindämmung einer grassierenden Ruhrepidemie in öffentlichen Einrichtungen Türklinken mit Mullbinden umwickelt wurden, die mit Desinfektionsmitteln getränkt waren. Nachdem zehn Leute diese Klinke angefaßt hatten, war sie dermaßen eklig und verschmutzt, daß man um Nichts in der Welt dort anfassen wollte. Man versuchte unter Vermeidung jeden Kontaktes die Tür mit Knie und Schuhspitze (nicht gleichzeitig!) zu öffnen.
Neben Koch, Wirtschaftsleiter und Betreuern gehörte mindestens ein Rot-Kreuz-Helfer immer zu einem Ferienlager. Der, welcher das Grebser Ferienlager betreute, war ein 413 Jahre alter Sanitäter, der sich auf Steinmetz- und Holzschnittarbeiten verstand. Zeichnungen geschickt mittels Hammer und Meißel auf sprödes Gestein zu übertragen – dazu war er imstande. Der ehemalige Sanitätsgefreite meißelte emsig wie ein Specht sechs Wochen lang Szenen und Motive eines Mansfelder Schachtes in ein paar Findlinge.
Vor Abschluß des Ferienlagers wurden alle Steine unter der alten Dorflinde zu einem kleinen Denkmal vermauert. Die Spitze bildete ein Stein, auf dem eine Wetterlampe zu sehen war. Darunter waren Kegelhalde und Fördergerüst dargestellt. Weiter waren ein Treckejunge und ein Häuer zusehen (für den ich damals mit einem Knüppel Modell gesessen habe). Den Sockel des Ganzen bildete eine Widmung. Im Großen und Ganzen war dieses Anderthalbmeter-Denkmal sehr gut gelungen. Während einer kleinen Feier mit Brause-Saufen zum Abschluß des Lagers wurde es dem Bürgermeister ‑und damit den Bürgern der Gemeinde Grebs- übereignet.
Mitten durch das Dorf verlief (heute natürlich ebenfalls noch als A2) die Autobahn Berlin-Helmstedt und wir Knirpse vom Land standen oft am Fahrbahnrand und staunten über die vorbeirasenden Westautos. 1955 mußte man relativ viel Geduld aufbringen, um zwischen zwei aufeinanderfolgenden Autos keine Langeweile aufkommen zu lassen; Spielen, direkt an der Autobahn und auf dem Mittelstreifen – damals kein Problem.
Später bin ich noch mehrmals mit dem Fahrrad dorthin gefahren, um ein paar Ferientage auf dem Bauernhof zu verleben. Die Radtouren führten mich über Sandersleben- Bernburg- Calbe-Schönebeck-Burg-Genthin und Brandenburg nach Grebs. Das ist nicht gerade eine Kurzstrecke und man sieht, wie sorglos Vater und Mutter sein konnten und ihrem elf-/zwölfjährigen Bengel solche Freiheiten ließen. Nun gut, die Straßen waren damals so gut wie leer. Hin und wieder ließ ich mich auch ein Stück von einem Lastwagen mitschleppen, indem ich mich einfach mit der Hand an der Ecke Seiten-/ Heckladeklappe festhielt; das machte damals fast Jeder und das wurde von den LKW-Fahrern toleriert.
Bei meinem Ferien-Bauern bin ich mit dem Pferdewagen (Trecker? – Nie gehört) auf die Felder gefahren und habe bei der Arbeit geholfen, so gut ich es vermochte. Auch das Pferdegespann durfte ich häufig selbst führen. Ich lernte die Grundkenntnisse des Angelns mit Rute, Reuse und Netz, habe auf allen Böden und in allen Winkeln nach Eiern gesucht, sammelte mit der Familie Pilze und staunte über 6‑Pfund-Riesenbrote. Was hier an einem Tag auf den Tisch kam, hätte unsere Drei-Kopf-Familie mehr als eine Woche ernähren können. Auf dem Hof arbeiteten noch ein Sohn mit seiner Frau und eine Tochter mit ‑nach deren Heirat- ihrem Mann. Ein anderer Sohn betrieb eine Stellmacherei und fertigte etwa zehn Jahre später ‑nach unserem Umzug von Siersleben nach Brandenburg- für uns Verandafenster an.
Heimlich entwendete ich das Moped (ein SR‑1) und holperte damit über Äcker, Wiesen und Frösche. Ich trank literweise Milch aus der Schöpfkelle. Diese hing immer in einer 20-Liter-Kanne, welche ihrerseits ständig in der Küche stand. Als absoluter Katzenfreund musste ich mit ansehen, wie junge Katzen ersäuft wurden und wie ein Lamm vom springenden Wollknäuel zum Hochzeitsbraten mutierte. Vor dem aggressiven angeketteten Hofhund Feodor hatte ich immer ein wenig Angst und tollte mit dem verspielten und etwas doofen Mischling Flocki über den Hof. Ich staunte, mit welcher Engelsgeduld die Bäuerin aller zehn Minuten die Hühner aus der Küche jagte, anstatt die Tür zum Hof zu schließen. Im Übrigen hütete ich am liebsten die Gänse.
Hier auf dem Hof sprang ich einmal in der Scheune vom Strohboden auf die Tenne – glaubte ich. Aber dort stand nämlich irgend ein Gerät, welches mit Stroh verdeckt war – gottseidank war es keine Egge. Noch heute ‑nach sechzig Jahren- schmerzt mir manchmal mein rechtes Fersenbein.
Winterferienlager
Winterferienlager wurden leider nur eine Woche lang durchgeführt. Dazu bezogen wir in Jugendherbergen im Harz Quartier. Ich erinnere mich da besonders an die Herberge oberhalb des Hagenteiches nahe Gorenzen und an die Herberge Schiefergraben, beides schöne alte Jagdhaus-Villen, die nach dem Krieg enteignet worden waren.
In der Herberge Gorenzen stand im Gemeinschaftsraum ein seltsames Ding, das wir nicht kannten. Ein ganz schlauer Bengel klärte uns auf: ”Das iss’n Fernseher, ihr Ochsen! Der iss wie Gino! Nur glainer! Hier musste dreh’n für leise un’ laud un’ hier kannste schald’n uff Ost un’ West”. Dazu stakste er seine Spinnenfinger auf die in purem Gold glänzenden Knöpfe und Schalter. Dunnerlittchen!

Abends kurz vor sieben Uhr saßen wir mit blitzblanken Augen vor dem Fernseher. Der Herbergsvater schritt gravitätisch heran und stellte sich breitbeinig en face vor das Gerät. Er streckte mit weit nach hinten gebeugtem Oberkörper einen Arm noch weiter nach vorn und schaltete zunächst einen Stromregler ein. Dieser sollte die stark schwankende Netzspannung, die oft bis zu 180 Volt herabsank, bei 220 Volt stabilisieren (Sehr viele Haushalte, die noch am 110-Volt-Netz hingen, mußten auch einen Transformator dazwischen schalten). Er drehte an einem Stufenschalter so lange herum, bis der Zeiger auf ein kleines rotes Dreieck wies. Ein kurzes, künstliches Zögern – ein Knacks… Nichts. Es wurde unruhig. Der Beherrscher des Fernsehers erhob Ruhe heischend den Arm »Ruh’ch - wahrded!«. Da – es zischte, knackte, zirpte und rauschte ein wenig und auf der Mattscheibe erschien zögernd und schemenhaft etwas Gesprenkeltes. Und wieder der Schlaumeier: ”Das is’ Gries; da is de Andenne nich’ richd’ch!” Aha – Antenne ‑klar doch, kannten wir.
Der Herbergsvater schien etwas ärgerlich zu sein, weil der Bengel ihm die Show zu stehlen drohte: ”Was Duu woh’j wedder alles waijst.« »Un um siem gommd de Uhr!” triumphierte der Bengel.
Und tatsächlich um neunzehn Uhr kam Bewegung in den Gries, dergestalt dass auf einem runden Ziffernblatt ein Sekundenzeiger von Punkt zu Punkt hüpfte. Alle starten wie gebannt darauf.
”Bassd uff, gleich ruggd d’r große Zeijer!” – Wieder dieser vorlaute Bengel. Und tatsächlich, auch der Minutenzeiger rückte nun um einen Punkt vor. Und schon wieder: »De’ Westuhr hat Schdriche, gaijne Bungkde!»
Atemlos verfolgten wir das Rasen der Zeiger. Nach sechzig Umdrehungen des Großen Zeigers – Punkt 20 Uhr: Goooonnnggg – und aus prasselnden und rauschenden Nebelschwaden heraus erschien geisterhaft eine schöne Frau im Abendkleid, lächelte und sprach zu uns (Die Ahle gann uns awwer nich’ sehn! kommentierte der Angeber wieder). Jetzt kämen zuerst Nachrichten und dann Dies und danach Das. Aber, keine Bange, sie selbst komme auch noch einmal wieder, um Dies und Jenes etwas genauer anzusagen. Das war mein erstes Erlebnis mir dem neuen Medium Fernsehen.
In diesem Winterferienlager avancierte ich zum Star. Nach einem Rodelwettbewerb – den Weg von der Herberge bis hinunter zum Hagenteich– erhielt ich abends bei der Siegerfeier drei »Goldmedaillen«. Ich freute mich wie Bolle.
Sowohl in den Sommer- wie auch in den Winterferienlagern war es Brauch ‑zumindest in den ersten Jahren- auch westdeutsche Kinder teilnehmen zu lassen. Diese Kinder hatten, wie wir, ebenfalls einen Bergmann als Vater und kamen aus dem Ruhrgebiet:
”Ich komme aus Geeelsenkiiirchen – und du kommst …?”
”Iche? – Äh – aus Sierschlemm.”
»Ahhh – und wo ist das?«
»Bei Eislemm!«
Später wurden diese Aktionen mit den Einladungen von Westkindern eingestellt und wir DDR-Kinder blieben unter uns.
In der Jugendherberge Gorenzen war ich später noch ein zweites Mal; unsere 9. oder 10. Klasse hatte dort eine Woche lang täglich zwei mal zwei Stunden Mathematik-Intensivunterricht. Was der Anlaß für diese Aktion war, weiß ich nicht mehr; vielleicht waren wir zu doof.
Als ich für ein Kinderferienlager mit fünfzehn schon zu alt war, nahm ich an Touren im Klassenverband teil. Wir fuhren mit Zelt und Rad nach Saalfeld, um dort auf einer Bergkuppe über der Stadt zu zelten. Die Anfahrt wurde über zwei Tage geplant, wobei der Zwischenstop mit Übernachtung auf den Saalewiesen in Bad Kösen erfolgte. Eine andere Fahrt führte uns an den Bremer- und Birnbaumteich im Harz und wieder eine andere, die Schulabschlußfahrt, brachte uns ‑zwar mit Zelt, aber ohne Fahrrad- nach Dranske / Bakenberg auf Rügen.
Örtliche Ferienspiele
Parallel zu den Betriebs-Kinderferienlagern konnte man an den von Schule und Gemeinde organisierten sogenannten Örtlichen Ferienspielen teilnehmen. Waren die Betriebs-Kinderferienlager kostenlos, mußte hier für einen Durchgang von drei Wochen symbolisch eine Mark gezahlt werden; für zwei Mark konnte auch an beiden Durchgängen teilgenommen werden.
Praktisch waren die Ferienspiele von Lehrern betreute Ganztagsbeschäftigung. Morgens trafen sich die Kinder in der Schule und es wurde den Tag gebastelt, Sport getrieben und Wanderungen durchgeführt. Kinobesuche standen genauso auf dem Programm, wie der Besuch der Badeanstalt im Nachbardorf Augsdorf. Es wurde ein erstaunlich abwechslungsreiches Programm geboten. Und wenn man mal keine Lust hatte, ging man einfach nicht hin. Ich habe mehrere Male an den Örtlichen Ferienspielen teilgenommen.
In jedem Schuljahr gab es zwei Wandertage, an denen uns hauptsächlich der Harz nahegebracht wurde. Mein erster Schulausflug führte uns auf den Brocken, welcher zu dieser Zeit noch frei zugänglich war.
Auch kann ich mich an einen Wandertag erinnern, an dem wir vom Bahnhof Rübeland aus zur Rappbodetalsperre und wieder zurück wanderten; gut 12 Kilometer. Die Rappbodetalsperre war damals noch im Bau und ihre spätere Mächtigkeit mit 105 Höhenmetern war der Baustelle beileibe noch nicht anzusehen. Andere Ziele waren die Burg Falkenstein, die Ausflugsgaststätten Selkemühle und Leinemühle, die Rübeländer Höhlen, die Klippmühle und der Vatteröder Teich. Andere Klassenfahrten führten uns später nach Ilmenau, Blankenburg, Erfurt, Artern. So lernte ich die verschiedensten Orte und Plätze im Harz kennen, zumal ich auch privat viele Touren dorthin unternahm.
Weitere Höhepunkte im Schulleben waren der Tag des Lehrers am 12. Juni und der Tag des Kindes am 1. Juni. An beiden Tagen fand Unterricht nur symbolisch statt. Es wurde vom Lehrer vorgelesen und die Mädchen der Klasse trugen Gedichte vor oder trällerten das eine oder andere Lied. Am Tag des Kindes fanden dann zusätzlich Wettspiele, wie Sackhüpfen und Eierlauf statt, und im Kino über Heklaus Kneipe wurde ein Film gezeigt. Es gab Bockwürste und Brause und ein Stück hausgemachten Kuchens und man konnte, an einer Seilrolle hängend, über den ganzen Schulhof sausen.
Das alles ging ohne Formulare, Stempel, Begutachtungen ohne Tiefbauamt und Straßenaufsichtsbehörde. Es waren kein ökologisches Gutachten und auch keine Umweltverträglichkeitsstudien erforderlich, und es gab auch keine Vorschriften, wie eine Kinderschaukel auszusehen hatte. Auch der Lebensraum des längsgestreiften Grashupfers wurde nicht beeinträchtigt. Man feierte. Einfach so. Und gab es doch mal ein Malheur, mußte kein Rechtsanwalt bemüht werden, der seinerseits einen Gutachter beschäftigte. Es war nicht erforderlich Beweise zu sichern, Zeugenaussagen festzuhalten und Schadensersatzforderungen abzuschmettern. Es war halt passiert und Alles kann passieren und Jedem kann etwas passieren. Gab es Unstimmigkeiten redet, man miteinander. Ohne Anwalt. Basta.
Leben mit Kampagnen I
Pionierschiff ‘Vorwärts’
Der Schulalltag und später auch die Lehrzeit waren durchsetzt und dominiert von der Propaganda der SED und deren Kampagnen. Meine erste bewußt erlebte Kampagne betraf ein altes, dänisches Schiff, daß 1952 an die DDR kam. Geldsammlungen sollten die Reparatur des alten Kahns finanzieren und je zwei Pioniere bekamen eine Sammelbüchse in die Hand gedrückt. Das Sammelergebnis kenne ich nicht mehr – aber zweimal zehn Pfennig für je eine kleine Kugel Eis bei Samtleben fielen ab. Deutlicher: Wir unterschlugen zwei Groschen, die wir aus der Büchse fingerten.
Das Schiff wurde unter dem Namen »Ernst Thälmann« der damaligen Volkspolizei zur See ‑später Grenzpolizei zur See, noch später Volksmarine- als Ausbildungsschiff zur Verfügung gestellt. Nach einer Kesselexplosion, Mitte der 50er, bekam es die Pionierorganisation geschenkt – den Kleinen das Beste!
Steine für Rostock
Eine weitere Kampagne betraf den Bau des Rostocker Überseehafens. Ziel war, daß Sammeln von Feldsteinen, mit denen die Mole in Rostock aufgeschüttet werden sollte. Alle Schüler der DDR waren aufgerufen ‑wie immer, freiwillig- Steine von den Äcker zu lesen – heute unvorstellbar.
Wir zogen mit Handwagen über Äcker und Wiesen über Feldwege und durch Gräben um Feldsteine zusammenzutragen. Die Steine waren schwer und man mußte aufpassen, die Wagen, die so zwischen drei und sechs Zentner tragen konnten, nicht zu überladen. Wenn die Wagen die Last auch trugen – für uns war sie zu groß. Wir stemmten uns mit dünnen Beinen auf lehmigen, nassen und schmatzenden ‑die Schuhe von den Füßen ziehenden- Ackerboden gegen zentnerschwere Wagen, zogen, schoben und schleppten diese keuchend und schweißtriefend über Weg und Steg zum Bahnhof, von wo aus sie dann ihren Weg in den Rostocker Überseehafen finden sollten.
Hochhaus an der Weberwiese
Weitere Kampagnen, an die ich mich zwar erinnere, mit denen ich aber keine unmittelbaren Erlebnisse verbinden kann, war der Bau der Stalinallee in Ostberlin. Viel Lärm wurde um das Hochhaus an der Weberwiese veranstaltet. Dieser Bau schaffte es sogar in das Lesebuch der zweiten Klasse.
Zu dieser Zeit gab es Bastelbögen zu kaufen, mit denen man vor allem Flugzeug- und Schiffsmodelle und eben auch die gesamte Stalinallee maßstabsgerecht nachbauen konnte; ich klebte mir zu Hause mit Kittifix meine eigene Allee samt Hochhaus zusammen.
Max braucht Wasser
Bis in die Lesebücher hinein fand auch eine andere Aktion ihren Weg, nämlich ”Max braucht Wasser”. Hier ging es um den Aufbau einer Druckwasserleitung zur Wasserversorgung der Maxhütte in Unterwellenborn. Im Lesebuch vereitelten ein junger Kommunist und FDJ-Mitglied und ein Nicht-Mitglied einen Anschlag ”Bonner Gehlen-Agenten” auf das Bauwerk des Friedens.
Weiteres Propagandagetöse betraf Meliorationsarbeiten im Oderbruch. Beispielsweise gab es da immer wieder Schlagzeilen, welche die ”Sozialistische Jugend in das Oderbruch” riefen, um dort die Friedländer Wiesen trockenzulegen um damit ”wertvolles Acklerland zu gewinnen”.
Große Friedenskämpfer
Überhaupt waren die Lesebücher der ersten Schuljahre mit so so etwas wie Heiligenlegenden gefüllt: Zwei junge westdeutsche Kommunisten, die Heidelberger Studenten Georg von Hatzfeld und René Leudesdorff, setzen 1950 nach Helgoland über, wo sie eine Fahne hissen, um gegen die Bombardierung der Insel durch die englische Luftflotte zu protestieren. Nach Kriegsende beschlossen die Engländer, die gesamte Insel zu evakuieren und dann zu sprengen, was aber technisch nicht gelang. Dieser militärische Mißerfolg wurde flugs umgewidmet in einen Erfolg besagter Jungkommunisten.
Weitere Märtyrer des Kommunismus jener Zeit waren das amerikanische Physiker-Ehepaar Ethel und Julius Rosenberg, die für den russischen Erzfeind Atomspionage betrieben und deshalb auf dem Elektrischen Stuhl hingerichtet wurden. Auch hier, wie in vielen Fällen: Ehren-Fahnenappelle, schnell gestrickte Friedenslieder und ergreifende Reden, die eigentlich immer ‑gleichgültig aus welchem Anlaß sie vorgetragen wurden- damit endeten noch besser zu lernen, um damit unsere DDR und denFrieden zu stärken.
Eine andere Friedenskampf-Ikone jener verrückten Zeit war der westdeutsche FDJ- und KPD-Funktionär Jupp Angenfort, der aus welchen Gründen auch immer, ”eingekerkert” war.
Auch Otto Krahmann war über Nacht ein Friedenskämpfer geworden. Er starb im Westen, wo er sich besuchsweise aufhielt, bei einer Wirtshausschlägerei unter Betrunkenen. Da er aber aus der DDR stammte, wurde daraus flugs ein ”feiger politischer Mord an einem aufrechten Friedenskämpfer” gestrickt.
Friedenskämpfer ‑ein Wort, das in den Fünfzigern bis zum Erbrechen benutzt wurde- kamen aber auch aus dem Ausland, zum Beispiel die junge algerische Anarchistin Djamila Bouhired, die sich in Frankreich an Eisenbahnschienen festkettete, um einen Waffentransport nach Algerien zu verhindern – so die DDR-Lesart. In Wahrheit deponierte sie in zwei algerischen Cafes Bomben, wurde zum Tode verurteilt, aber aufgrund ihrer Jugend (21) begnadigt und ist heute (2019) in Algerien immer noch eine Heldin.
Leben mit Kampagnen II
Halt dem Amikäfer!
Tütenlampen und schwarzen Zimmerdecken mit roten, gelben und grünen Dreiecken, sondern auch Jahre großer Maikäferplagen. Heute kennt man Maikäfer, wenn überhaupt, dann nur noch dem Namen nach. Aber damals schwirrten in den Abendstunden Myriaden dieser Krabbeltiere um Kastanien und Birken. Jeder Dorfjunge sammelte sorgsam fachmännisch ausgewählte Krabbeltiere in einer mit Kastanienlaub gefüllten und mit Luftlöchern versehen Pappschachtel und erklärte den Kleineren wichtig, worin sich ein Bäcker von einem Schornsteinfeger und beide wiederum vom Müllerunterscheidet. Bei einer Kutsche lachten die Erklärenden verlegen und meinten von Oben herab zum Jüngeren “Das verstähsde nich, dazu bistde noch zu glaijn”. Sie verstanden es selbst nicht.
Wenn die Gefangenen durch “Pumpen” einen unmittelbar bevorstehenden Fluchtversuch ankündigten, wurde durch “Abklatschen” dieser vereitelt. Hatte man von den Spielkäfern genug, wurden sie leidenschaftslos den Hühnern zum Fraß vorgeworfen, die sich fast närrisch gebärdeten ob dieser Leckerbissen. Die Kehrseite der sechsbeinigen Krabbler waren kahlgefressene Bäume, so daß wir öfters mal Schüler schulfrei bekamen, um Maikäfer einzusammeln. Es galt, die Bäume oder zumindest Äste, kräftig zu rütteln und schon regnete es Maikäfer en masse. Jetzt mußte sehr schnell gehandelt werden, denn die am Boden liegenden Käfer pumpten kräftig, um zu fliehen. In dieser Phase mußten sie flink aufgelesen und die bereits Startenden wieder abgeklatscht werden. Das Ergebnis solcher Käfermassaker waren fast randvoll mit Wasser und Maikäferkadavern gefüllte 200-Liter-Ölfässer, welche die Luft verpesteten und Hühner, die mit kugeligen Mägen einhertaumelten und unter Völlegefühl litten.
Das Absurde dieser Maikäfervernichtung war die Behauptung, “westdeutsche Gehlen-Agenten” würden diese Plage im Auftrag der imperialistischen USA hervorrufen (Gehlen-Chef der bundesdeutschen Spionageabwehr). Gehlen-Agenten waren damals so ziemlich an Allem schuld, was in der DDR nicht geplant war: Mißernten, Brände, Zugunglücke, Explosionen, knappe Waren und vieles andere mehr. Selbstverständlich war Gehlen auch für die damals typischen Kartoffelkäfer-Plagen verantwortlich. Auf Propagandaplakaten trugen die Ami-Käfer statt ihrer normalen gelb-schwarzen Flügeldecken, solche mit den amerikanischen Stars And Stripes. Auch zum Sammeln der Kartoffelkäfer gab es schulfrei, weshalb es bei den Schülern gar nicht so unbeliebt war. Sie wurden in Marmeladengläsern gesammelt und in einem kleinen Reisigfeuer verbrannt.
Heute weiß ich, daß schon im Ersten und später auch im Zweiten Weltkrieg sowohl von allierter, als auch von deutscher Seite, Überlegungen angestellt wurden, Kartoffelkäfer als biologische Waffe einzusetzen. Ganz so unbegründet schien die Propaganda wohl doch nicht zu sein…
Sparmarken
Die Auszahlung solcherart erarbeiteter Beträge erfolgte durch den Lehrer. Bei der Auszahlung wurde geworben, für den vollen oder auch für Teilbeträge, sogenannte Sparmarken zu kaufen, die der Lehrer bei sich hatte. Wir besaßen fast alle ein Sparheft, das war eine DIN-A7-Klappkarte mit vorgedruckten Rechtecken, in die die briefmarkenähnlichen Sparmarken eingeklebt werden konnten. Die Werte der Sparmarken betrugen zehn und fünfzig Pfennig sowie eine und zwei Mark. Sparmarken konnte man übrigens zu jeder beliebigen Zeit in der Schule oder auch in der Sparkasse kaufen. War das Sparheft voll, ging man damit zur Sparkasse, wo der Betrag einem normalen Sparkonto gutgeschrieben und mit ‑ich glaube- drei Prozent verzinst wurde; man erhielt ein neues, leeres Sparheft.
Von der Idee her war dieses Verfahren hervorragend geeignet, zur Sparsamkeit zu erziehen, auch bei Pfennigbeträgen.
Aber nicht alles wurde in Sparmarken investiert; ich erinnere mich da an die vielen Bonbon-Gläser bei Lina Bombach in der Haupstraße und Carl Naumann in der Gartenstraße, in denen viel Zuckerzeug lag und ‑das ist wichtig- ohne Lebensmittelkarten gekauft werden konnten: Maiblätter, Himbeerbonbon, Vollmich-Drops-Rollen, Lakritzschlangen und ‑pfeifen, rot-weiße Pfefferminztafeln, Brausepulver und Sucusa, ein schleimlösendes Lackritz-Präparat aus Prochnows Apotheke. Ebenfalls dort erhielt man in kleinen, runden Pappdöschen Niespulver, das man schnüffeln mußte, um sofort eine Viertelstunde lang ununterbrochen niesen zu können.
Die Sommer-Erntefront
In jedem Jahr bliesen alle gleichgeschalteten SED-Medien zu neuen und doch immer den gleichen propagandistischen Großangriffen. Vor allem die Getreideernte wurde vom Trommelfeuer der Presse, des Rundfunks begleitet (Fernsehen war noch nicht verbreitet). Schon im Vorfeld und lange vor der Ernte und für den normalen Bürger unsichtbar gab es strategische Entscheidungen zur ”Ernteschlacht”. Da gab es Rapporte zur Ersatzteil‑, Treib- und Schmierstoffsituation und wenn erforderlich, wurde auch die sonst heilige Staatsreserve angegriffen. Straßenbaumaßnahmen während der Erntezeit waren verboten, beziehungsweise durften den Einsatz von Erntegeräten nicht behindern. Bei der örtlichen Versorgungslage, vor allem von Obst und Gemüse, wurden Sonderkontingente eingeplant. Der staatliche Wetterdienst gab tägliche Erntewetterberichte an die Kreisleitungen der SED heraus, Anzahl und Art der Erntehelfer wurden zentral disponiert und mit den entsprechenden Institutionen abgestimmt. Vor allem Studenten, Polizisten in Ausbildung, Soldaten (auch russische), Lehrlinge, die niedere Funktionärs-Qulique der SED-Kreisleitungen, Angestellte aus Betrieben und Institutionen und wir Schüler waren diejenigen, die man, wenn es losging, auf die Felder beorderte um die Ernte »verlustfrei zu bergen”. Örtliche Freiwillige Feuerwehren wurden eingeschworen und ”potentielle Löschwasserentnahmestellen instand gesetzt”, das hieß, verkrautete Naturgewässer wurden gesäubert. Auf allen Partei- und Kommunalebenen wurden Operative Diensthabende installiert. An den Feldrainen standen volle Dieselfässer und bereitstehende Reparaturtrupps waren mit Werkzeugen und Hilfsmitteln bestens präpariert. War der Erntezeitpunkt heran, brach dann über Nacht der ”Erntesturm” los: ”Stolze Erntekapitäne” ”kämpfen” auf den Feldern um das ”Ährengold in allerhöchster Qualität”. Sie und ihre Kollegen aus den Verwaltungen traten zur ”Ernteschlacht” an. An der ”Weizen‑, Roggen‑, Gerste‑, Mais‑, Rüben- und Kartoffelfront” herrschte immer fröhliche Stimmung und vor allem ”keine Waffenruhe”. In den Medien sah man immer lachende Menschen, die sich über ihre 12-Stunden-Schichten freuten. Es gab im Dorfkonsum statt der verdreckten und vollgesudelten Flaschen des sonst üblichen Sanddorn- und Rharbarbermostes plötzlich auch Apfelsaft; Limonade schien aus unerschöpflichen Quellen zu sprudeln und volle Bierkästen stapelten sich in allen Winkeln. Sogar Bananen tauchten auf den Erntefotos der Zeitungen auf. Wimpel wurden den ”besten Traktoristen” und ”Ehrenbanner” den ”unermüdlichen Erntekollektiven ” überreicht. Es hagelte Auszeichnungen, Geld- und Sachprämien (Schiffsreisen, Fernsehgeräte). Begeisterte Leserbriefe füllten die Spalten der Zeitungen und Fernsehreporter hatten fast Tränen in den Augen angesichts des ”unermüdlichen, aufopferungsvollen und begeisterten Kampfes” aller ”Kräfte und Mittel”. Funktionäre hielten mit sich überschlagenden Stimmen ”flammende Reden”. Plakate wurden geklebt, Losungen gepinselt und Transparente aufgespannt, auf denen die ”Bonner Ultras” , die ”Kriegstreiber”und Spalter der Nation gewarnt wurden, das Volkseigentum anzutasten, weil ihnen sonst die Arbeiter und Genossenschaftsbauern, die ”Angehörigen der Intelligenz” sowie überhaupt das friedliebende Volk auf ihre ”schmutzigen Finger” hauen würde.
Nach vier Wochen war die Luft wieder raus und die ”Ernte geborgen”. Alles normalisierte sich. Im Laden gab es natürlich keine Bananen und keinen Apfelsaft, Limonade und Bier gab es wie immer nur sporadisch und Brot war nach 15 Uhr wie üblich ausverkauft. In weiser Voraussicht angeforderte und nicht verbrauchte Ersatzteile für den Trecker wurden in Ölpapier eingewickelt. Plakate und Transparente verblichen und die aufgemalten Losungen konnten bei Bedarf wieder aufgefrischt werden.
Die Herbst-Erntefront
Nach der Beendigung der Sommerkampagnen zur Getreideernte wurde im Herbst mit bedeutend weniger Medien-Getöse an die ”Rüben- und Kartoffelfront” ausgerückt. Jetzt galt es das »weiße Gold” und die ”nahrhaften Knollen” zu bergen. In der Presse erschienen Leserbriefe, in denen mitgeteilt wurde, daß alle Bewohner eines Feierabendheimes für ihr Leben gern Pellkartoffeln essen. Das war die Aufforderung, kleine Kartoffeln bei der Ernte nicht zu übersehen. Was in anderen Ländern einfach Kartoffel- oder Rübenernte hieß, mutierte in der Nachkriegs-DDR zu einem »erbitterten Ringen um hohe und höchste Ernteerträge« zu einem »Friedenskampf auf dem Feld«, um den »Bonner Ultras« mal wieder zu zeigen, was eine ”sozialistische Harke” ist. Jede normale Aktivität, jeder selbstverständliche Handgriff, jeder noch so triviale Vorgang wurde von übereifrigen Funktionären umgewidmet in eine klassenkämpferische Aufgabe.
Vom Ich zum Wir
Gut erinnere ich mich an Propaganda-Plakate, die als Serie gestaltet waren. Auf den Plakaten waren immer zwei Bilder zu sehen: Ein ”werktätiger Einzelbauer” und ein Genossenschaftsbauer. Der Einzelbauer blickte immer gequält und voller Gram von seiner Arbeit auf, während der Genossenschaftsbauer stets lächelnd und mit leichter Hand seiner Tätigkeit nachging.
Untertitelt waren diese Plakate stets gleich, nämlich mit ”Vom Ich zum Wir”. Dieser Slogan sollte den Bauern den Beitritt zu einer Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) nahebringen. Es war typisch für die damalige Zeit, nicht mit sachlichen Argumenten zu werben, sondern auf einer sehr wackligen »Spaß«- oder »Satire«-Schiene sich diesem Thema zu nähern. Durch diese Denkart wurden dumme und platte Knittelreime zusammengeschustert, die einem grausten:
Bist ein Einzelbauer Du, hast Du niemals Deine Ruh' - VOM ICH ZUM WIR oder Tritt ein in die Genossenschaft, sie vervielfacht deine Kraft! - VOM ICH ZUM WIR oder Warum quälen, hetzen plagen? Tritt ein, dann ist Arbeit Wohlbehagen! - VOM ICH ZUM WIR
Trotz dieser zündenden Reime wollte es mit dem Beitritt zur LPG nicht so richtig klappen und so verschärfte man zunächst den Druck auf die Einzelbauern - so die Bezeichnung für einen Bauern, der kein Genossenschaftsmitglied war. Und damit niemand auf den Gedanken kommt, ein Einzelbauer liege nur den lieben langen Tag im Heu, mußte es richtig politisch korrekt ”werktätiger Einzelbauer” heißen; ”werktätige Genossenschaftsbauern” allerdings gab es nicht, sie waren einfach nur so Genossenschaftsbauern.
Einzelbauern hatten ein Ablieferungssoll aufzubringen, das nur sehr schwer zu erfüllen war. Die Bauern besaßen keine Maschinen und kein Gerät, um das Soll zu erfüllen, hinzu kam, daß viele Bauern als Neubauern keine Erfahrung hatten. Das erkannte sogar die SED richtig und führte auf dem Land die »Maschinen-Ausleih-Stationen« (MAS) ein. Hier konnte sich Einzelbauern Maschinen, Traktoren und anderes Gerät ausleihen. Parallel dazu wurde die ”Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe” (VdgB) gegründet, eine Einkaufsgenossenschaft und Verteilorganisation für Saatgut, Düngemittel, Baumaterial u.ä.
Die Siersleben nächst gelegene MAS befand sich in Klostermansfeld; die VdgB wurde am Ende der Mittelstraße, unten, Im Sack etabliert. Die MAS wurden einige Zeit später umbenannt in MTS (Maschinen-Traktoren-Station), wobei das Ausleihprinzip bestehen blieb.
Da der Zustrom zur LPG weiterhin nicht so recht ins Rollen kam, rollte etwas anderes heran: Ein LKW mit blaubehemdeten Agitations- und Propaganda-Gruppen, kurz AgitProp-Gruppen. Das waren zumeist, aber nicht immer, Berufsfunktionäre, die die dümmlichen Vom-Ich-Zum Wir-Plakate umsetzten in noch viel plattere Sketche, wobei dieses Wort nicht gebraucht werden durfte, sondern stattdessen Stegreifspiel anzuwenden war, obwohl es alles andere war, nur eben kein Stegreifspiel. Die Bauern wurden genötigt, sich vor dem LKW aufzustellen und die Funktionäre oben machten sich zum Affen mit humoristischer Propaganda. War nach einer halben Stunde das Kasperle-Theater beendet, rollte der LKW zum nächsten Dorf und so weiter.
Als auch das nicht dazu führte, daß die Einzelbauern Schlange standen, um einen Aufnahmeantrag auszufüllen, wurde man rabiat: Man setzte das Abgabesoll höher, nötigte die Bauern zu Versammlungen, spaltete mit Gerüchten und anderen Aktionen den Zusammenhalt im Dorf, drohte mit der Steuerfahndung (bis zum letzten Jahr der DDR ein beliebtes Mittel), konnte auf der MTS plötzlich kein Traktor mehr repariert werden, in der VdgB waren keine Treibriemen mehr vorhanden usw.
Damit hatte das System endlich Erfolg. Binnen kürzester Zeit waren fast alle Einzelbauern freiwillig der Landwirtschaftlichen Produktinsgenossenschaft (LPG) beigetreten. Die Vergenossenschaftung erfolgte in drei Stufen, demzufolge gab es LPG vom Typ Eins, Zwei und Drei. Beim Typ 1 war zum Beispiel nur die Feldbewirtschaftung genossenschaftlich, während die Viehhaltung individuell blieb – und damit natürlich das Abgabesoll für Milch und Eier – ruck zuck nach kurzer Zeit waren alle Typ 1‑Genossenschaften in solche vom Typ 3 umgewandelt, in der absolut alles Genossenschaftseigentum war.
Besonders den alteingessenen Bauern, die mit ihrem Grund unter der 100-Hektar-Enteignungsgrenze lagen, aber mit vielleicht 80 Hektar wirtschaftlich in einer anderen Liga spielten, als ein Neubauer ‑vielleicht ehemals Uhrmacher in Grünberg- mit seinen 7 Hektar, fiel der Beitritt zu einer LPG sehr schwer.
1000 Traktoren
Kurz nach der Gründung der MAS wurde wieder mit riesigem Propaganda-Aufwand eine Kampagne gestartet: 1000 Traktoren: Die große, ruhmreiche Sowjetunion schenkt der DDR eintausend Traktoren.
Zitat Neues Deutschland vom 25.02.1949
Berlin (ND). Helle Freude herrscht bei den Arbeitern und bei der werktätigen Landbevölkerung unserer Zone über die Mitteilung des Vorsitzenden der DWK, Heinrich Rau, daß die Sowjetunion uns in so großzügiger Weise mit tausend erstklassigen Traktoren, mit Lastkraftwagen und mit Walzmaterial zur Herstellung von Ersatzteilen für unsere landwirtschaftlichen Maschinen und Geräte zu Hilfe kommt …
Wie immer (zuletzt beim Maislied, s.u.), wurde im Unterricht flugs dieses neue Lied gelehrt:
Strophe 1 (Deutsche Panzer in Rußland): ”Tausende Panzer zerstörten das Land, brachten nur Tod und Verderben.…”
Strophe 2 (Russische Traktoten in Deutschlandd): ”Tausend Traktoren durchpflügen die Saat…”
Natürlich wurde nichts geschenkt, denn zu dieser Zeit lief die Demontage ganzer Werke und die des zweiten Gleises der Reichsbahn auf Hochtouren. Ich selbst habe dabei zugesehen, wie Arbeiter auf der Strecke Klostermansfeld-Hettstedt am Bahnhof Siersleben ein Gleis der bis dato zweigleisigen Strecke demontierten. Darüber wurde nicht gesprochen.
Leben mit Kampagnen III
Westpaket und Bettelbrief
Einige Monate lang, an das genaue Jahr kann ich mich nicht mehr erinnern, lief eine Verleumdungskampagne der lokalen SED, gegen die Verfasser sogenannter ”Bettelbriefe”, der sich natürlich das lokale SED-Kreisblatt »Freiheit« anschloß. In diesem Blatt wurden Personen ‑meist alleinstehende Frauen- unter voller Namensnennung in redaktionellen Schmähartikeln angegriffen. Das Schreiben von »Bettelbriefen in das imperialistische Westdeutschland«, so der groteske Vorwurf, würden den Stolz der friedliebenden DDR-Bürger verletzen. Dazu wurden Textauszüge aus den Briefen zitiert. Das Schlimme an dieser Kampagne war, daß mit solchen Aktionen an niedrigste Instinkte der Dorfbewohner appelliert wurde. Es gab Anfeindungen, Tratsch und Neid. Auch Denunziation nach Blockwart-Manier kam vor. Der Inhalt solcher Pakete war in den ersten Nachkriegsjahren teilweise überlebensnotwendig, manchmal einfach nur brauchbar und manchmal auch überflüssig, in allen Fällen aber waren sie willkommen. Schließlich enthielten sie jene Dinge, die im plangewirtschafteten Arbeiter – und Bauernstaat nicht oder schwer erhältlich waren. Da viele Vertriebenen- (DDR-Sprachgebrauch:Umsiedler-) familien katholisch waren, erhielten diese regelmäßig Pakete von westdeutschen kirchlichen Organisationen oder Gemeinden. Das Sammeln der Adressen und Namen Bedürftiger erfolgte auf innerkirchlichen Wegen ohne aktives Zutun der Begünstigten.
Kampf dem Ochsenkopf
Es war sehr belastend, beim Hören eines Westsenders ständig an der Abstimmung nachzuregeln, um zu verstehen, was gerade gesagt wurde. In der DDR wurden überall Störsender betrieben, die den Empfang des gesprochenen Wortes westlicher Radiostationen mit Pfeifen, Rauschen und Blubbern störten. Es war einfach nervenaufreibend, es war unerträglich.
Da kam eine neue technische Entwicklung gerade recht: Anfang der sechziger Jahre lernte der UKW-Rundfunk das Laufen und auch das Fernsehen fand immer schneller neues Publikum. Es sprach sich rasend schnell herum, daß UKW-Sender nicht so intensiv gestört werden konnten und man Nachrichtensendungen kristallklar verstand. Beide jungen Medien benötigten allerdings für einen guten Empfang große und hochstehende Antennen (in Yagi-Form), die natürlich am besten auf dem Dach montiert wurden. Da sie aber auf den Sender ausgerichtet werden müssen, signalisierten diese übedimensionalen Dachzeiger jedem die ideologische Einstellung des Eigentümers. Es war offensichtlich: Das Gros aller Antennen zeigte in die ideologisch unerwünschte Himmelsrichtung.
Der SED bereiteten zunehmend auf Dächern montierte Antennen Sorgen, die anstatt zum Petersberg in der Nähe Halles zum Brocken blickten.
Verbindet man auf einer Landkarte den Petersberg mit dem Brocken im Harz, so durchschneidet diese Linie genau das Mansfelder Land. Nun gehörte zwar der Brocken zur DDR und demzufolge befand sich auch der darauf befindliche Sender fest in Arbeiter- und Bauernhand, aber der unmittelbar daneben liegende und fast genau so hohe Wurmberg wurde von den Kriegstreibern für Fernseh- und Radiosender mißbraucht, die nach Osten abstrahlten.
Bürger mit gefestigten Klassenstandpunkt, also die Minderheit, richteten ihre Antennen nach Südosten aus. Alle sahen es: Ich liebe die DDR.
Das Gros der Antennen allerdings zeigte in Richtung Nordwest. Alle sahen es: Guckt und hört der nun Brocken oder Wurmberg / Torfhaus? Beides war ja möglich. Schnell sprach sich herum, daß man hier und da abendliche Lauscher am Fensterladen gesehen habe (ich kenne noch heute einen), die wohl erkunden, was für ein Sender empfangen wird. Nach einem halben Jahr war das Problem gelöst: ”Aus technischen Gründen mußte die Polarisation des Senders Brocken geändert werden; alle Bürger werden gebeten das zu beachten und ihre Antennenanlagen entsprechen zu ändern.” Wer ab sofort wirklich (und nicht nur wie behauptet) den Sender Brocken empfangen will, müßte seine Antennen von der Horizontalen in die Vertikale drehen. Nichts drehte sich… Hhmm. Siehe auch hier: DER SPIEGEL 37–1961
FDJ-Kontrollgruppen
Die Lösung dieser Starrköpfigkeit waren sogenannte »FDJ – Kontrollgruppen«. Auf Befehl und praktisch über Nacht rüpelten DDR-weit Eiferer und Funktionäre gegen Eigentümer falsch stehender Antennen. Nach eigenem Verständnis kämpften diese Gruppen für den Frieden, allerdings aber immer im Dunkel der Nacht. Diese Horden kletterten auf Dächer, um Antennen abzuknicken oder herunterzureißen. Die Wut und Tränen der Eigentümer wegen ihrer zerstörten Dächer (versuche mal einer auch nur einen einzigen Dachziegel zu kaufen) kümmerten die fanatischen Friedenskämpfer nicht. Es kam zu Schlägereien und Anzeigen; Unruhe verbreitete sich, war doch das deckungsgleiche Gebaren der SA noch Vielen gegenwärtig.
Angeblich empörte Bürger forderten in Zeitungen in einer neu erschaffenen Rubrik ”Kampf dem Ochsenkopf” das Ausrichten von Antennen auf DDR-Sender (Der Sender Ochsenkopf selbst befand sich überhaupt nicht im Empfangsgebiet des Mansfelder Landes).
Eine weitere Ruhmestat dieser nächtlichen Friedenskämpfer unseres Dorfes bestand im Herunterreißen eines bronzenen Adlers von der Spitze eines schlichten Granitobelisken, der an die Gefallenen des Krieges 1870/71 und an die beider Weltkriege erinnerte.
Parolen (»Pfaff’ Du warst nicht zur Wahl, ob Krieg oder Frieden ist Dir egal!«) wurden nächtens geschmiert und vielleicht auch die eine oder andere private Rechnung beglichen. Das Ganze drohte auszuufern, denn der aufgekommene Vergleich mit der SA ließ die SED schnell handeln und der Spuk war nach vielleicht drei Wochen wieder vorbei.
Im Ergebnis dessen, was sie erlebten, bauten viele Einwohner ihre Antennenanlagen unter das Dach. Andere ließen den Ideologiezeiger demonstrativ nach Nordwest weisen. Es war eine Periode der Hysterie. Jeder Jugendstreich, jede »Disziplinlosigkeit« in der Schule wurden geahndet, indem der Verursacher einen Aufsatz schreiben mußte. In diesem Aufsatz hatte er zu erklären, daß das Hören von Westsendern ihn zum Zerschlagen einer Fensterscheibe oder zum Kirschenklauen angestiftet hätte. In meiner Lehrzeit wurden diese »Bekenntnisse« üblicherweise öffentlich an die Wandzeitung angeschlagen.
Radio Luxemburg
Viele Sonntage ‑um Zwei Uhr nachmittags- saß unsere Clique vor dem großen Röhrenradio, das ich jedesmal von zu Hause in unseren Jugendklub in der Hettstedter Straße geschleppt hatte. Wir versuchten, im 49-Meter-Band Radio Luxemburg einzustellen; Punkt 14 Uhr ging Camillo mit seinem Sidekick Frank und seiner Erfindung »Hitparade« auf den Sender. Zwei Stunden lang verfolgten wir die Sendung.
Man konnte zwar auch den Nordwestdeutschen Rundfunk (NWDR) empfangen, aber das war normales Programmradio und Musik war dort eher Mangelware.
Little Richard, Elvis Presley, Johnny Cash, Chuck Berry, Bill Haley … deren Titel allerdings waren auch auf Radio Luxemburg weniger zu hören; dafür war dann AFN zuständig. Ständig war ich auf Mittel- und Kurzwelle unterwegs, um AFN oder RIAS einzufangen; es war nervende Fummelei einen Sender ständig nachstimmen zu müssen. Pfeifen, Rauschen, Zwitschern, Fading – es war ein ständiger Kampf mit dem Radio. Bei Dunkelheit fielen auf Kurzwelle Dutzende Sender ein, die sich alle gleichzeitig aus dem Lautsprecher quetschen wollten, es war nahezu unmöglich einen Sender zu halten – zu viele tummelten sich im Äther. Es war zum Verzweifeln – UKW-Rundfunk befand sich noch in den Startlöchern und die Standorte von RIAS und AFN befanden sich auch nicht gerade in der Nähe.
Jeder von uns Teenagern war in dieser Zeit ganz verrückt nach einem Kofferradio. In der DDR wurden zwar einige Modelle produziert, aber wie eben üblich, ganz schwer zu erhalten. Mein Freund Wolfgang hatte als Erster unserer Clique Glück und konnte einen kleinen Puck erwischen und wenig später zeigte uns Erhard sein Sternchen. Mir gelang dann aber auch irgendwann Anfang 1960 der große Wurf und ich hatte endlich einen Rema-Trabant an einem grünen Lederriemen über der Schulter hängen. Ein großes, zwei Kilogramm schweres Röhrenungetüm mit ‑sehr wichtig- einer gespreizten beidseitigen Skala für Kurz,-, Mittel- und Langwelle. UKW? – Wurde erst Mitte der 60er in der DDR eingeführt.
Schlager und Politik
Anfang der sechziger Jahre startete der FDJ-Zentralrat unter dem Titel »Schlager und Politik« (wieder einmal) eine Kampagne, um uns Jugendliche, deren Idole Elvis Presley, Peter Kraus oder Ted Herold waren, zum sozialistischen Schlager zu bekehren. Die Basis dieser Kampagne war ein zentral produziertes Magnetband, welches an alle Schulen, Berufsschulen usw. verteilt wurde. Auf dem Band waren je zehn Ost- und Westschlager ausschnittsweise zu hören. Die Texte der Schlager wurden von einem Sprecher im Stile eines Karl-Eduard von Schnitzler (oder war er es selbst?) kommentiert. Er wies haarscharf nach, daß Westschlager Gewalt und Krieg verherrlichen, während die sozialistischen, lebensfrohen Lieder optimistisch in eine frohe Zukunft verwiesen.
Auf dem Band vertreten waren zum Beispiel »Heimweh« und »Hast Du noch eine Zigarette, Kamerad« von Freddy Quinn, »Morgen« von Ivo Robic, »Tom Dooley« mit den Nielson Brothers und Andere.
Diesen West- waren Ostschlager gegenübergestellt worden, von denen einer der Bärbel-Wachholz-Titel »Damals« war. Und genau wegen dieses Titels wurde die ganze Kampagne erst recht zum Flop. Wir, die zu Bekehrenden, drehten den Argumentationsspieß ganz einfach herum und behaupteten, die blonde Bärbel verherrliche die Nazizeit (»… damals war alles so schön. Doch wir waren viel zu jung, um unser Glück zu versteh’n… «). Natürlich wurde uns erklärt, daß dem nicht so sei – aber genau diese Argumente würden dann auch auf ”Heimweh” zutreffen usw .…
Es war einfach albern. Nach kurzer Zeit verschwand das Band aus den Schulen und die Kampagne war zu Ende.
Eine besondere Rolle in der damaligen Zeit spielte der »Deutsche Freiheitssender 904«, der vorgab von Westdeutschland aus zu senden. Ab 21 Uhr brachte dieser Sender eine Stunde lang DDR-Propaganda, unterbrochen von westlicher Musik. Mit diesem Kunstgriff – der im Prinzip auch funktionierte – bot man der DDR – Jugend (obwohl offiziell nicht die Zielgruppe) Westschlager und Ostpropaganda in Einem. Nach Ende der einstündigen Propagandasendung wurde auf die Mittelwellenfrequenz 935 gewechselt und der gleiche Sender versuchte nach dem gleichen Konzept nun aber als »Deutscher Soldatensender« die Soldaten der Bundeswehr zu indoktrinieren.
Freizeit war kein Vergnügen
Unsere Kinderspiele
Gemeinsames Spielen mit anderen Kindern war ein wesentlicher Punkt meiner Kindheit. Wenn ich mir Pieter Bruegels Bild »Die Kinderspiele« anschaue, steigen viele Erinnerungen an Spiele auf, die wir alle noch kannten und spielten.
Spiele wurden nicht geplant, sie ergaben sich aus der Situation, aus Lust, Laune, Wetter, anwesende Freunde, Gelegenheit usw. Vor allem Kraft- und Mutspiele, wie Reiterkampf, Bockspringen, Wettlauf, Schweinebaumeln, Balancieren, waren bei uns Jungen beliebt; etliche besaßen Stelzen, so auch ich. Dagegen standen Spiele, wie Rockdrehen, Völkerball, Blinde Kuh, Hochzeit, Plumpsack, Stille Post, Himmel und Hölle (Hickeln), bei den Mädchen höher im Kurs.
Im zeitigen Frühling wurde vor allem der Kreisel über den Boden getrieben. Kreiselkünstler unter uns waren in der Lage, das kleine Holzdings auch über Kopfsteinpflaster zu peitschen.
Auch Reifentreiben war ein Spiel, welches in den 50ern noch nicht ausgestorben war; besonders geeignet als Spielgerät waren Fahrradfelgen. Man konnte ewig lange den Reifen durch das Dorf treiben, so ein Ding kippte einfach nicht um.
Ein Freund von mir, Klaus, mit dem ich gerne Ami und Russe spielte, besaß einen Autoreifen, mit dem er immer angab und auch noch versuchte Gewinn zu machen: Willsde aach ma’ roll’n? – Fünf Gullerschösse…
Mit Klaus’ Monster-Gummireifen spielten wir mitunter Ikarus-Bus (ungarische Ikarus-Busse waren die ersten Frontlenker und begannen gerade, sich die Straßen des Ostblocks zu erobern); dazu nahm ich ein Rad meines überlebensgroßen Holzpferdes vor meinen mageren Bauch, drehte es hin und zurück, schaltete … brmm, brmm und fuhr los – ich war der Fahrer, Kumpel Klaus das Busrad. Er trieb keuchend seinen schweren Reifen neben mir her, meinen Lenkbewegungen folgend. Auch bergauf – Tüüüt.
Beim Schweinebaumeln kam es darauf an kopfüber an einem Ast, einer Mauerkrone o.ä. zu hängen. Typische Jungen-Spiele waren Messerstechen, Kaulquappen- oder Regenwürmerfressen, Schornsteine verstopfen, Vogelnester ausnehmen, bzw. Vögel mit der Zwille (Schlappschlauder) ermorden. Ja, manchmal nahmen Vögel Schaden, wobei ich feststellen muß, daß das Schießen mit der Zwille auf lebende Ziele nicht jedermanns Sache war, auch die meine nicht; aber genauso gut kann ich mich an einen Jungen aus Augsdorf erinnern, der das geradezu fanatisch und mit funkelnden Augen tat.
Messerstechen war natürlich harmlos: Es galt ein Taschenmesser, das mit seiner Spitze auf verschiedenen Teilen der Hand, des Gesichtes und anderen Körperstellen stand, so herabfallen zu lassen, daß es sich genau einmal um sich selbst dreht und im Boden stecken bleibt.
Das Spielen mit Murmeln (Gullerschösse) war ebenfalls ein typisches Frühlingsspiel; warum es im weiteren Jahresverlauf nicht mehr gespielt wurde – ich weiß es nicht. Die Murmeln wurden in einem ausgedienten Strumpf der Mutter transportiert.
Das Grundkontingent an Murmeln kaufte man für ganz kleines Geld stückweise bei Kunze am Denkmalplatz. Wer am geschicktesten war, ging mit deutlich dickerem Strumpf wieder nach Hause.
Besonders begehrt waren Klicker oder Bucker – größere Murmeln, deren Größe ihren Wert als Äquivalent einer Anzahl normaler Murmeln bestimmte. Als besonders wertvoll wurden Glas- und Stahlkugeln angesehen. Der Haupt-Spielort war die Südseite des Denkmals.
Beim Pfennigschlagen ‑wir sagten klimpern- kam es, ähnlich wie beim Murmeln, auf etwas Geschicklichkeit an. Das Schönste daran war, daß man einen, zwei oder drei Pfennige gewinnen konnte.
Im Sommer bewarfen wir uns, im Teich stehend, mit darin schwimmenden Pferdeäpfeln, da dort die Bauern ihren geplagten Arbeitsgäulen gern eine Feierabend-Abkühlung gönnten. Ihre Äpfel waren aufgrund des Wassers besser formbar, als das trockene Krümelzeug, das auf der Straße lag und von alten Leuten für ihre Blumen gesammelt wurde – Klatsch …
Versteck(en) und (Ein)fangen (Jochen) mit und ohne Freischlagen zu spielen, war bei Mädchen und Jungen gleichermaßen sehr beliebt. Diese Spiele dehnten sich fast jedes Mal über Stunden und über das gesamte Dorfgebiet aus, genauso, wie Schnitzeljagden, die uns bis in den Welfesholzer Wald und auf die (Hohlen (Halden) des Glückhilfs- und Niewandtschachtes führten.
Auch das Eisrudern gegen Ende des Winters auf dem Dorfteich wurde überwiegend von uns Jungen gepflegt: Wir standen auf schwankenden Eisschollenstückchen im eiskalten Wasser und versuchten, mit einem Brett oder Knüppel rudernd, voranzukommen. Hin und wieder mußte auch jemand pitschenaß nach Hause gehen, wo er dann in der Regel den Wanst voll kriegte.
War das Eis noch intakt, liefen wir Schlittschuh. Diese wurden mit Riemen unter normale Schuhe geschnallt und mit Absatz- und Sohlenkrallen mittels einer kleinen Vierkantkurbel daran festgekrallt. Trat man unglücklich auf oder knickte seitlich ab, schmerzte es nicht nur, sondern auch der Schuhabsatz wurde regelmäßig gleich mit abgerissen. Die Schuhmacher Sierslebens hatten im Winter gut zu tun.
An Wasser fehlt’s im Revier
Das Mansfelder Land ist relativ arm an Wasserflächen. Wenn man im Sommer baden wollte, wurde es etwas eng. Obwohl wir hin und wieder mal am und im Dorfteich spielten, war das kein Ersatz für ein richtiges Baden. Haupt-Körper-Erfrischungsanstalt für uns Sierslebener war sicherlich das Freibad in Augsdorf. Es war in den 50ern schon nicht mehr nagelneu und etwas glitschig und grün war es auch – aber, es erfüllte seinen Zweck. Wir badeten gern in diesem Bad. Beim Kauf der Eintrittskarte ‑die Preise weiß ich nicht mehr- konnte oder mußte man wählen: Einzel- oder Gemeinschaftskabine (Guhschdallj).
Ein weiteres Freibad befand sich in Großörner. Es war bedeutend größer als das Augsdorfer Bad und verfügte ‑Donnerwetter- über eine zentrale Beschallung: Man konnte Bärbel Wachholz, Julia Axen und Günter Geißler hören und ‑nochmals Donnerwetter- mit der eigenen Stimme andere Badegäste grüßen – huuii…
Leider lag das Örnersche Bad nicht gerade in der Nachbarschaft; man mußte nach Thondorf, über den Hettstedter Weg und durch den Regenbeck mindestens zwei Tage hin- und doppelt so lange zurücklaufen.
Bad Anna in Helbra war nur ein- oder zweimal mein Ziel – und wenn ich mich recht entsinne, wollte ich dort lediglich mit dem Ausleih-Ruderboot etwas Piraten-Feeling erleben.
Häufiger waren wir im Hettstedter Tonloch baden. Es lag zwar auch nicht in unmittelbarer Nähe, aber es hatte keinen Beton-Rand, enthielt kein Chlorwasser und war einfach angesagt. Da es relativ tief war, konnte es nicht schaden, schwimmen zu können – also, nur etwas für Angeber.
In der kalten Jahreszeit war ich öfters ‑vor allem mit meinem Kumpel Hansi- im Hallenbad im Hettstedter Klubhaus der Walzwerker. Hier war der Bademeister so etwas wie der Sonnenkönig: Ein Absoluter Herrscher. Er verlangte tatsächlich, beim Duschen Seife zu benutzen und dabei die Badehosen auszuziehen! Und zu allem Überfluß kontrollierte er nach dem Duschen auch noch unsere Füße sehr genau; pingelinger ging es nicht. Aber – wir erlernten in kurzer Zeit bei diesem Bademeister Schwimmen und erhielten das Frei- und das Fahrtenschwimmerzeugnis (15 Minuten Schwimmen, Sprung 1‑Meter-Turm / 45 Minuten Schwimmen, Sprung 3‑Meter-Turm und 3 Meter Scheibentauchen). Leider war in der Regel die Badezeit auf eine oder zwei Stunden begrenzt.
Nach dem Schwimmen setzten Hansi und ich uns entweder in die im Obergeschoß befindliche Bibliothek, um etwas zu lesen oder wir schlürften im D‑Zug-Wagen eine Maggi-Brühe mit Ei und Brötchen für vierzig Pfennig. Ohne Ei zwanzig Pfennig.
Machten wir uns auf den Heimweg, nutzten wir hin und wieder die noch damals angebotene Personenbeförderung durch die Deutsche Post. Man konnte das nach Plan (!) fahrende Postauto am Bahnhof Hettstedt abwinken, der Fahrer riß einen normalen Fahrschein (0,40 MDN) vom Block, wir nahmen auf der Rückbank Platz – und ab ging die Post.
Ein Mal ‑unvergeßlich für mich- ging nicht die Post, sondern die Bahn ab: Ein Onkel von Kumpel Hansi war Lokomotivführer bei der Mansfelder Bergwerksbahn (Schachtbahn) und nahm uns mit – von der Hettstedter Kupferhütte, vorbei an Eduard- und Niewandtschacht, bis hin zum Gleisdreieck Siersleben. Von hier aus fuhren auch Personenzüge zu den einzelnen Betrieben des Mansfeld-Kombinates. Der Personenzugverkehr wurde irgendwann mit der Installation eines dichteren Busnetzes durch das Mansfeld Kombinat eingestellt.
Der Landfilm kommt
”Die Kinder des Kapitän Grant”, ”Lockendes Glück”, ”Es blinkt ein einsam Segel”, »Mount Everest«, »Till Eulenspiegel« – diese und viele andere Filme waren unvergessliche Ereignisse meiner Kindheit, auch, wenn sie teilweise ideologisch arg belastet waren. Filme hatten einen völlig anderen Stellenwert als heute. Filme waren faszinierende Ausflüge in andere Welten.
Einmal in der Wocxhe kam der sogenannte Landfilm, eine Art Kino auf Rädern, in die Nachbardörfer Sierslebens. Montags hier, dienstags dort, mittwochs anderswo usw. Gefiel ein Film besonders gut, konnte man ihn drei‑, viermal ansehen. Der Eintritt kostete ‑glaube ich- fünfundzwanzig Pfennig. Ob der Landfilm auch in Siersleben direkt Station machte, daran erinnere ich mich nicht mehr. Ich glaube aber eher nicht, da ja unser Dorf ein richtiges Kino im ehemaligen Tanzsaal im Obergeschoß der Gaststätte Heklau besaß.
Die Landfilmvorstellungen fanden im Saal eines Dorfgasthauses statt ‑in Augsdorf war es die Linde, in Thondorf die Erholung und in Hübitz … tja, … habe ich vergessen. Im Sommer gab es ständig Probleme mit der Verdunkelung des Saales, so daß mancher Film optisch nicht wirklich prickelnd war.
Der Landfilm-Mann kam mit zwei uralten Bogenlampen-Projektoren und etlichen blechernen (Brandschutz!) Filmkisten, in denen die Filmrollen für die nachmittägliche 15-Uhr-Kindervorstellung und die abendliche Erwachsenen-Vorstellung transportiert wurden. Er stellte seinen ganzen Krempel an einem Saalende auf und spannte am anderen Ende die vielfach geflickte Leinwand und stellte den Lautsprecher auf. Er richtete die Bilder beider Projektoren kantengenau aus und wenn der Film nicht riß, was hin und wieder vorkam, versprach der Nachmittag ein Erlebnis zu werden, trotz der laut ratternden Projektoren, der Umspul-Geräusche und klappernder Filmkisten im Hintergrund.
Heklau’s Kino
Wie soeben gesagt, Siersleben besaß ein richtiges Kino in Heklaus Kneipe und immer Mittwoch, Sonnabend und Sonntag gab es Vorstellungen. Kindervorstellungen waren nur sonntags angesetzt. Hier sah ich als Knirps viele der sowjetischen Märchenfilme um Baba Jagas, Eisköniginnen, dumme Iwans und Schöne Wassilissas. Und tapfere Taschapajews.
Später, als auch ich die 14-Jahre-Grenze für die Abendvorstellung überschritt, konnte man endlich alle Filme anschauen, solange die Altersgrenze nicht auf P16 oder P18 festgesetzt war. In diesen Fällen erschlichen wir uns den Film, indem wir auf unrechten Wegen auf die Bühne, hinter die Leinwand gelangten und uns so den Film (seitenverkehrt) ansahen.
Obwohl das Kino immer recht gut besucht war, nahm der Andrang manchmal beängstigtende Ausmaße an, wenn Filme aus dem Westen gezeigt wurden. Neben anspruchsvollen Filmen, wie »Lohn der Angst« und »Rocco und seine Brüder«, waren es vor allem harmlose Streifen wie die Spessart-Filme mit Lilo Pulver, Die Hazy-Osterwald-Story (mit herausgeschnittenem Kriminaltango), dänische musikalische Komödien mit Siw Malmquist usw.
Neben dem Hauptfilm wurde jedesmal die DEFA-Wochenschau »Der Augenzeuge« und öfters auch »Das Stachelschwein« gezeigt, letzteres eine politisch-satirische Propagandaserie, in der jedesmal ein unaufmerksamer DDR-Bürger Schaden nahm, weil er auf Westpropaganda hereinfiel.
Hin und wieder wurden auch Vorfilme gezeigt, oft über den Wechsel der Jahreszeiten in irgendeiner Ecke der ruhmreichen Sowjetunion. Der Sprecher intonierte pathetisch und irgendwann fielen dann singende russische, tartarische, usbekische, ukrainische und andere ‑ische seltsame Frauenstimmen ein. Bin ich jetzt ein Kulturbanause?
Richtiges Kino
Neben Landfilm und Heklaus Kino zog es uns auch in die Kinos der nächsten Kreisstadt, nach Hettstedt. Ja – das war doch etwas ganz Anderes, das war richtig weltstädtisch: APOLLO und UNITAS stand in Leuchtbuchstaben über den Eingängen und man konnte zwischen zwei Sitzkategorien wählen! Sperrsitz und Parkett! Und – es gab eine richtige 17-Uhr-fast-Erwachsenen-Vorstellung! Nicht so ein Kinderkram wie nachmittags um drei Uhr.
Das Apollo war etwas beliebter, weil der Weg von Siersleben (fünf Kilometer Landstraße, vorbei an der Hohle des Eduardschachtes und die Hettstedter Bahnhofstraße hinunter) etwa zwei Kilometer kürzer war, als das in der Stadtmitte (Meisberger-/Lange Straße) liegende UT.
Gegenüber des Apollo, auf der anderen Straßenseite, stand ein Kiosk, an dem man sich mit Süßigkeiten ‑im Rahmen unserer Pfennigbeträge- eindecken konnte; Lakritzeschlangen und ‑pfeifen machten eine herrlich schwarze Zunge.
Wie gesagt: Heklaus Kino in Siersleben besaß keinen solcherart klangvollen Namen wie die Hettstedter, es hatte überhaupt keinen Namen – es hieß einfach Kino, besaß nur eine Klappstuhlkategorie und war im Winter schweinekalt, obwohl ein Riesenofen versuchte dem abzuhelfen.
Halbstark
Die 50er waren das Jahrzehnt, in dem der Begriff Halbstark unter das Volk kam und auch wir taten alles, um in unserem kleinen Dorf als Solche wahrgenommen zu werden. »Wir«, das war ein Teil der Jugendlichen Sierslebens – etwa die Geburtenjahrgänge 1942 bis 1947 mit Ausrutschern nach oben und unten. Insgesamt waren wir so etwa dreißig Typen, die in unterschiedlichem Maße als halbstark galten oder gelten wollten oder es waren:
Der harte Kern
Der harte Kern ‑ein reichliches Dutzend, mich inbegriffen- war bekannt im Dorf durch seine hhmm… Aktivitäten, zu denen der eine oder andere Streich gehörte, beispielsweise folgender: Während einer Kino-Abendveranstaltung wuchteten wir zwei gefüllte Aschetonnen etwa zwanzig Stufen hinauf, die zum Kassenvorraum des im Obergeschoß von Heklaus Kneipe befindlichen Kinos führten. Wir plazierten die Tonnen direkt vor der doppelflügligen Tür, die den Kassenraum gegen die Treppe abschloß. Nach Vorstellungsende versuchte die Kartenabreißerin, die während der Vorstellung am Lautstärkeregler drehte und auch Kassenfrau war, die Tür aufzustoßen, welches wegen der davor stehenden Aschetonnen ihr aber nicht gelang. Den aus dem Kinosaal drängenden Menschen aber widerstanden sie nicht und wurden von beiden Türflügeln über die oberste Stufe geschoben. Laut polterten beide Tonnen und ihre Riesendeckel die Treppe hinunter und blieben unten vor einer geschlossenen Windfang-Tür liegen. Unten die Tonnen, oben eine dichte Wolke aus Asche und Staub, auf der Treppe Dreck und Abfall und wütende, erboste, sich nach unten kämpfende Kinobesucher.
Schon als die Tonnen begannen, staubend herabzudonnern, war uns klar, daß wir schleunigst das Weite suchen mußten, wollten wir nicht von der aufgebrachten Menge gelyncht werden. Glücklicherweise hat uns kein Außenstehender beobachtet und so verliefen die Nachforschungen des Dorfpolizisten im Sande – in der Asche, sozusagen, obwohl natürlich jeder im Dorf ahnte, wer die Verursacher waren. Erst als wir nochmals darüber redeten, ging uns auf, daß dieser Streich so harmlos nicht war …
Die Unentschlossenen
Ein zweites Dutzend (vielleicht auch mehr) suchte mehr oder weniger die Nähe des harten Kernes der Clique, hatte aber ein ambivalentes Verhältnis zu ihm. Irgend etwas passte nicht ganz so recht. Einer war etwas zu jung und der andere fühlte sich etwas zu alt und ein weiterer mußte immer um acht Uhr abends zu Hause sein. Wieder andere fühlten sich im Zwiespalt zwischen Elternautorität und dem Rebellieren gegen dieselbe unwohl; sie waren gefangen zwischen Baum und Borke, waren unentschlossen, trauten sich nicht so recht – oder waren Mädchen. Oder alles zusammen.
Trotz der zeitweilig nur losen Bindungen zwischen beiden Gruppen, war aber die Freundschaft zwischen Allen aufrichtig ‑auch über die inzwischen vergangenen Jahrzehnte- und niemand kam auf die Idee, das anzuzweifeln.
Ging es am Wochenende zum Tanzen nach Sandersleben in die Diele, wie das Tanzlokal Drei Linden genannt wurde, waren sie nicht oder nur vereinzelt dabei. Ebenso, wenn wir testeten, wieviel Bier noch in Karl Höckes Fässern schwappte. Lediglich beim Rumhängen in der Buswartehalle, beim Kinobesuch oder in unserem selbstrenoviertem Klubraum schlossen sie sich zeitweise dem harten Kern an.
Die Verweigerer
Natürlich gab es Jugendliche (eigentlich weniger als ein Dutzend) in Siersleben, die mit dem Versuch einer halbstarken Subkultur in einem Mansfelder Dörfchen nichts anzufangen wußten. Diese Teenager waren die Guten, die moralisch Überlegenen, die, welche sich morgens brav ihren Seitenscheitel kämmten. Sie bedurften keiner besonderen Aufforderung, sich bei entsprechenden Gelegenheiten das FDJ-Hemd anzuziehen.
Andererseits war es aber auch nicht so, daß der Umgang mit ihnen unsererseits vermieden worden wäre, aber sie wollten ‑aus eigenem Entschluß- eben einfach nicht dazugehören. Trotz Allem – man kam im Großen und Ganzen sehr gut miteinander aus.
Haare, Hosen und Krawatten


Damals wie heute: Das Wichtigste am Teenager-Sein ist die Frisur. Die meisten ‑auch ich- hatten auf dem Kopf ein Brikett liegen: Die Haare zu einer Elvis-Tolle aufgetürmt und mit Haaröl, alternativ mit Butter oder Margarine, so getränkt, dass das Zeug auch schon mal an Schläfen und Stirn hinunter rann. Am Hinterkopf stießen die an den Schläfen nach hinten gekämmten Haare durch gleichzeitiges Schneiden mittig zusammen und bildeten eine Ente, auch Entenarsch. Das Ganze wurde komplettiert durch sich nach unten verbreiternde Koteletten, die bis zur Halsschlagader reichten. Einen Bart jedweder Art oder Stoppeln wegen nachlässiger Rasur gab es nicht.
Vor allem wir Mitglieder der Kern-Clique orientierten uns klamottenmäßig und auch im Habitus an unseren damaligen Idolen, als da waren James Dean und Marlon Brando als amerikanische und Horst Buchholz und Karin Baal als deutsche Filmidole. Und natürlich waren, was die Musik betrifft, Rock ’n’ Roll und dessen Protagonisten angesagt: Elvis Presley, Chuck Berry, Bill Haley – Peter Kraus und Ted Herold sowieso. Wir wollten so sein wie sie, wir wollten so aussehen wie sie – w i r aus Siersleben!
Das Tragikomische war, dass wir auf unserem Dorf die Filme nur vom Hörensagen, durch ihre Programmhefte, Autogrammkarten, Radiobeiträge u.ä. kannten. Nur Einer oder zwei hatten sie in Westberliner Kinos gesehen. Hosen mußten unbedingt so schmal geschnitten sein, daß das Anziehen Mühe bereitete. Da es solche aber nicht zu kaufen gab, waren schnell zwei, drei Namen im Umlauf, wo diese Änderungsarbeiten gegen kleines Geld durchgeführt wurden. Die Niet- oder Nietenhose begann gerade erst ihren Siegeszug anzutreten und war noch weit davon entfernt als Jeans ein Pflichtkleidungsstück ganzer Generationen zu sein. Eines aber war extrem wichtig: Aus einer Gesäßtasche hatte immer ein bestimmtes Modell eines Stielkammes herauszuragen.
James Dean wurde auf Bildern stets mit Cordhosen dargestellt, deren Stoff so gewebt war, daß ein winziges Pepitamuster entstand; dazu gerade aufgesetzte Taschen ‑sensationell! Alle wollten James-Dean-Hosen. Dank meines Bruders, der Schneider und von meinem Quengeln genervt war, hatte ich als Erster solcherart Hosen mit ‑und das war der Hammer- an den Taschenecken aufgesetzten kleinen, roten, dreieckigen Lederflecken.
Die weißen T‑Shirts, die Marlon Brando und James Dean trugen, wurden von uns Dödeln als Opa-Unterhemden angesehen (was sie ja auch waren) und erst später als Nicki angenommen.
Wir trugen in jener Zeit ein Sakko – mitunter mit schwarzer oder roter Lederkrawatte, die sehr schmal sein sollte. Wer eine Jeans trug, war mit einer Kunstlederjacke aus (Handelsname Lederol ) über kariertem Baumwollhemd richtig angezogen; auch Bluson oder Windjacke waren okay. Was notfalls ebenfalls ging: In Hüfthöhe abgeschnitte karierte Hemden mit dort eingezogenem Gummizug.
Sonntags, zu Tanz- und anderen Veranstaltungen sah man uns im einreihigen Anzug mit gerade eingestecktem, weißen (Kavaliers-) Brusttuch. Dazu gehörten ein weißes Hemd und eine mit Windsorknoten gebundene schmale Krawatte – häufig einfarbig in Schwarz oder Silber.
Auf dem Tanzsaal sagte man noch “Därf’ch bidden?”, wenn man mit einem Mädchen tanzen wollte und verneigte sich dabei bis kurz vor dem Überkippen. Bejahte sie, half man ihr beim Aufstehen mit dem Wegrücken des Stuhles und man ging eingehakt (“Der Herr führt”) auf das Parkett. Nach dem Tanz ging es wieder genauso zurück und man schob ihr vorsichtig den Stuhl unter, um ihr beim Hinsetzen zu helfen – so, als hätte sie keine Hände. Oder einen Sonnenbrand.
Verneinte sie, ging man mit hochrotem Kopf zu seinem Platz zurück oder an die Bar, je nachdem, wie souverän das eigene Ego oder welcher Weg der kürzere war.
Alternativ zur Krawatte wurde eine Lincoln-Schleife (von uns Lingelnschlaife genannt) getragen. Ein Sommermantel oder ein Trenchcoat gehörte zum Anzug dazu; es war um 1960 herum, als die Zeit der sogenannten NATO-Plane und des Nyltesthemdes begann. Winters waren dreiviertellange Mäntel mit Bindegürtel und Raglan-Ärmeln, dazu Lederhandschuhe, das Richtige. Egal, ob Wintermantel, Sakko, Bluson oder Hemd – immer mußten der Kragen und das Revers aufgestellt sein – nur so war man halbstark. In Siersleben.
Wegen der starken Luftverschmutzung durch Flugasche war der innere Hemdkragen schon nach sehr kurzer Zeit verschmutzt, die Aschepartikel rieben am Hals und lagerten sich überall ab – man konnte sie sich aus den Ohrmuscheln wischen und von der Kopfhaut klauben.
Lederschuhe waren immer sehr begehrt aber knapp, denn die Vorkriegs- oder auch Friedensware war allmählich verschlissen. Im Westen ersetzte man das Leder durch Naturkautschuk und im Osten durch Igelit. Schuhe aus ersterem waren oft schreiend zweifarbig, sehr gern grün-weiß, mit dicken, absatzlosen, weichen, hellen Sohlen und wurden als Kreppschuhe (Creepers) bezeichnet. die Ost-Alternative waren Igelitschuhe, ein Kunststoff aus Weich-PVC, der genauso aussah (gelb-braun marmoriert), wie er sich schreibt und anhört. Solcherart Schuhe waren im Sommer lappig-weich und zwei Nummern zu groß. Dabei standen die Füße im eigenen Wasser und die Ösen der Schnürsenkel rissen aus. Im Winter dagegen erwiesen sie sich als höllisch glatt und umschlossen, fest wie Eisen und als Ausgleich eine Nummer zu klein, die Füße des Trägers. Zu allem Überfluß brachen in der Kälte die Gehfalten der Schuhe, die man im Warmen mit Bindfaden wieder nähen konnte. Auch mit einem heißen Bügeleisen und einem Flicken konnte man die Brüche wieder zusammenpappen. Igelitschuhe, ‑mäntel, ‑taschen und andere Dinge wurden in sogenannten Biwa-Läden (billige Waren) angeboten. ”Rudis Reste Rampe”& Co. sind wahre Einkaufstempel gegenüber BiWa. So wie heute Jugendliche, die keine Markenkleidung tragen, gemobbt werden, wurde damals bei schlechtsitzenden Kleidungsstücken spöttisch gefragt »biwa?”.
Dann, als Teenager, mußten unsere Schuhe Slipper mit möglicht schmaler Spitze sein. Kappen und genähte Sohlenränder waren tabu. Und knallen sollten die Schuhe auch – auf dem Pflaster und auf dem Tanzboden erst recht. Deshalb waren unter Absatz und Spitze Eisen genagelt, alles andere war biwa.
Zu solchen Schuhen gehörten die richtigen Socken. Die zu den Kreppschuhen getragenen, albernen Ringelsocken waren nicht mehr angesagt. Socken waren bis in die 60er hinein schmal längsgestreift, und zwar immer mit schwarz, also gelb-schwarz, rot-schwarz, blau-schwarz. Einer von uns gab immer an mit schwarz-schwarz.
Rock ’n’ Roll im Jugendklub
Im Rahmen eines NAW-Projektes war der Ausbau eines kleinen, leerstehenden Hauses in der Hettstedter Straße, gegenüber des Örnerschen Weges. Im Obergeschoß sollte ein Jugendklub entstehen, während im Erdgeschoß ein Kinderhort einziehen sollte. Dieses Projekt wurde uns zum Ausbau als Jugendclub angeboten. Wir mauerten und tischlerten, wir setzten Fenster und Türen ein, es wurde gehobelt und gestrichen, elektrische- und Wasserleitungen verlegt. Richtig gut waren wir.
Zum Tag der Einweihung gab es eine große Fete. Alles wurde dekoriert mit Laternen, buntem Krepp- und grauem Klopapier. Getränke und Fettbemm’ wurden herangeschafft und ein Bierfaß die Treppe hinaufgewuchtet. Im Vorfeld wurden schwarz besorgte Schallplatten konspirativ auf ein Tonband überspielt, so daß niemand die kostbaren Scheiben mitbringen mußte. Dann waren die ganze Nacht Peter Kraus und Ted Herold, Bill Haley und Elvis Presley, Wanda Jackson, Little Richard, Little Eva, Carl Perkins und andere Rock ’n’ Roll-Götter in Siersleben zu Gast.
Doch – wir hätten statt dessen lieber Lutz oder Bärbel singen lassen sollen, denn am nächsten Morgen waren wir ziemlich ernüchtert, als wir zwischen einigen zerschlagenen Stühlen, einer zerbrochenen Türscheibe, zerbrochenem Garderobenständer und Anderem im jetzt wieder ziemlich renovierungsbedürftigen Jugendklub herumstanden. Da sah man, mal wieder, wohin es führt, wenn man keinen Lipsi tanzt. Die Skeptiker im Dorf schienen recht zu haben – aber, wir machten uns erneut an die Arbeit und renovierten alles gut – Ende gut.
Angehörige unserer Generation ‑allerdings jenseits des Atlantik- waren die Ersten, die mit dem Rock ’n’ Roll das begründete, was heute unter Popkultur verstanden wird. Ein paar Spritzer dieser Welle gelangten bis in unser kleines Mansfelder Land, in dem wir nach besten Kräften uns bemühten, ebenfalls halbstark zu sein. Zwar hörten wir auch Schlager, aber nur der Rock ’n’ Roll war die Musik, die unser Lebensgefühl repräsentierte. Die etablierten (westlichen) Radiosender waren stockkonservativ und demzufolge extrem zurückhaltend, was diese Musik betraf. Lediglich der amerikanische AFN ließ rocken und rollen – nur war er schlecht zu empfangen.
Fast unmerklich erfolgte der Übergang in die Twist-Ära, die Chubby Checker mit seinem Superhit »The Twist« einläutete. Die damaligen Alten, heute habe ich selbst dieses Alter schon um 20 Jahre überschritten, lachten oder schüttelten den Kopf. Ich erinnere mich, wie wir eines Tages in der Diele in Sandersleben seinen brandneuen Limbo-Rock so lange pfiffen, bis die Musiker auf der Bühne (Jawohl, Live-Musik – etwas anderes gab es nicht) ihn drauf hatten.
Teile der Bevölkerung lehnten diese Negermusik, dieses Geheule und Gezapple ab. So stand es schließlich in der Zeitung. Die »Heulbojen« Presley, Haley und Kraus ‑später kamen noch die Stones und die Beatles (Ulbricht: »… mit ihrem Jäh, Jäh, Jäh oder wie das alles heißt, ja…«) hinzu- wurden verteufelt und niedergemacht. Viele Bravbürger machten ihrer Empörung in Leserbriefen an des SED-Kreisblatt Freiheit Luft. Heute wissen wir, was wir damals nur vermuteten, nämlich, daß es redaktionell verordnete, ausgedachte Leserbriefe waren.
Einschub, Mai 2021: Und heute?
Die Ablehnung unserer Gruppe durch einige Siersleber wurde sicher auch gespeist durch die damals üblichen Halbstarken-Krawalle bei Auftritten von Protagonisten des Rock ’n’ Roll (Stones in derDeutschlandhalle Berlin) oder nach Filmvorführungen (berüchtigt: Außer Rand und Band mit Bill Haley And His Comets); sie machte uns störrisch: Jetzt erst recht.
Andererseits: Wir waren Zähmungsversuchen seitens der kommunalen Macht auch nicht generell abgeneigt; in uns steckte noch nicht diese militante Totalverweigerung späterer Generationen.
So funktionierte ein Haushalt
Wie muß man sich einen Haushalt in den 50ern vorstellen? Der gravierendste Unterschied zu heutigen Haushalten läßt sich festmachen an der Verfügbarkeit und der Anwendung der Elektrizität – In den 50ern bedeutete dies:
Erstens: Man hat helles Licht und Zweitens: Man kann (Mono-) Radio hören. Mehr nicht.
Das bedeutete: Kein Staubsauger, keine Kaffeemaschine, keine Kaffeemühle, keine Spülmaschine, keine Mikrowelle, kein Kühlschrank, kein Wasserkocher, keine Waschmaschine, kein Allesschneider, kein Trockner, kein Zweitradio, kein Rasierer.
Weiter: kein Computer / Notebook incl. WLAN, Router und DSL, kein Fernseher, kein Videorekorder, kein CD-/DVD-/Blu-Ray-/MP3-Player, keine Elektrowerkzeuge zum Bohren, Schleifen, Sägen, Nähen, kein Rasenmäher.
Keine Batterie-Geräte, wie: Uhr, Wecker, Video- und Fotokamera, Spielzeug, Telefon, Smartphone und auch keine 46 Ladestationen; alles war hand- bzw. federwerkbetrieben oder war schlichtweg noch nicht erfunden.
Sparsam ‑mit der Zeit aber zunehmend- waren mit Elektrokocher mit offenliegender Spirale, Tauchsieder, Staubsauger und Bügeleisen der Haushalt ausgestattet.
Die Art der Elektroinstallation war zu dieser Zeit sehr einfach: In jeder Zimmermitte hing eine Lampe. Dazu kam eine Steckdose je Raum. Flur, Waschküche, Nebengebäude, Treppen, Hof, Speicher, Bodenkammer, Keller, (Trocken-) Abort verfügten häufig über keinerlei Elektroinstallation. Die verfügbare Spannung des Elektronetzes betrug sowohl 110 Volt als auch 220 Volt- je nach Wohnlage und Straße im Dorf; die Umstellung auf einheitliche 220 Volt erfolgte Ende der 50er Jahre.
In der Nachkriegszeit gehörten regelmäßige Stromsperren zum normalen Tagesablauf. Eine feste Rubrik in der regionalen Tagespresse (Die Freiheit) informierte über Zeit und Dauer geplanter Stromsperren; meist waren es morgens und abends etwa 30 bis 60 Minuten. Neben den geplanten gab es aber auch noch häufige ungeplante Stromsperren.
Da kaum elektrische Geräte vorhanden waren, war eine zeitweilige Stromsperre eigentlich nur in der dunklen Jahreszeit störend. Um Knie und Kopf zu schonen, waren im ganzen Haus an festen Orten Kerzen mit daneben liegenden Streichhölzern verteilt. Beides gehörte unabdingbar zu den Sachen, die immer greifbar waren.
Rundfunk & Fernsehen
Ein Röhrenradio war in den 50ern bereits Standard, auch wenn es in manchen Haushalten noch die alte Göbbelsschnauze war. Nach dem Einschalten dauerte es etwa eine halbe Minute, bis man etwas hörte. Empfangen werden konnte auf Lang‑, Mittel- und Kurzwelle. Manche Geräte mußten mit einer einfachen Draht-Antenne und Erdung betrieben werden. UKW-Rundfunk war zwar technisch gerade entwickelt, hatte sich aber noch längst nicht durchgesetzt. Erst ab Beginn der 60er tauchten die ersten UKW-Antennen auf den Dächern auf.
Das Rundfunkprogramm unterschied sich von den heutigen durch eine sehr klare Struktur und durch eine unglaubliche Vielfalt; Ostsender hin – Westsender her: Reportagen, Quiz, Kommentare, Berichte, Hörspiele, öffentliche Übertragungen, Sport, Garten, Hobby, Kinderfunk, Schulfunk und und und..
Musikalisch wurde jedes nur denkbare Genre bedient: Klassisch, Schlager, Chanson, Latin, Rock, Country, Swing, Boogie, Oper und Operette, Jazz, Tatespiele, Kinderfunk usw. Klammert man die technische Qualität einmal aus, war Radiohören in den 50ern ein Vergnügen.
Fast täglich habe ich zweimal eine halbe Stunde den Schulfunk des NWDR gehört und so erfahren, wer Scott und Amundsen waren, was Asteroiden sind und das Nürnberger Ei war, daß der Mars Kanäle haben soll und vieles mehr. Der Rundfunk der Bonner Ultras hat mir nicht geschadet, ganz im Gegenteil.
Dann, zu Beginn der 60er Jahre, standen die ersten Fernsehgeräte in den Läden: Dürer, Rubens, Rembrandt, Sonata, Leningrad und wie sie alle hießen. Sie gab es anfangs noch auf Bezugsschein und deshalb wurden in den Dörfern Gemeinschafts-Fernsehstuben eingerichtet. Leider weiß ich nicht mehr genau, wo das in Siersleben war – ich glaube irgendwo in der Hettstedter Straße, bin mir dessen aber sehr unsicher.
Unser erstes Gerät ‑ein tschechischer Tesla- mußten wir aus Klostermansfeld abholen. Aber wie? Diese Dinger waren halbe Kleiderschränke und hatten locker ihre dreißig Kilogramm Gewicht. Als Transportmittel diente, wie immer, das Fahrrad. Vater und ich fuhren mit einem Rad – dergestalt, daß abwechselnd einer von uns beiden etwa 500 Meter fuhr, das Fahrrad an einen Chausseebaum lehnte und zu Fuß weiterging. Erreichte der Andere das Rad, fuhr der ‑den Ersten überholend- wieder etwa 500 Meter weiter vor, lehnte das Rad an den Baum, ging zu Fuß weiter und so fort.
Diese Art mit mehreren Personen ein Fahrrad zu benutzen, war weitverbreitet und als Teenager kamen wir damit auf das eine oder andere Dorf zum Tanz.
Hier fällt mir ein, daß mein Fahrrad einmal in irgend einem Harzdorf von den ortsansässigen Jugendlichen weit in die Mitte einer Jauchegrube geworfen wurde und wir mit viel Mühe und unter schallendem Gelächter und Gespotte das Rad mit aneinander gebundenen Harken wieder an’s Ufer hievten. Unter einer Pumpe befreiten wir es von dem stinkendgrünen Klitsch und der Heimfahrlauferei stand nichts mehr im Wege.
In Klostermansfeld also wurde das neue Fernsehgerät auf den Gepäckträger des Fahrrades gehoben und mit einer Wäscheleine befestigt. Den Rückweg legten wir zu Fuß zurück, wobei Vater das Rad führte und ich den Fernsehkasten im Gleichgewicht hielt.
Der Fernsehapparat beendete das Dasein unserer Guten Stube: sie wurde zur Fernsehstube, in der sich fortan die Nachbarn gern zusammenfanden, um sich ab 19:00 Uhr die Fernsehuhr anzugucken. Nach einer Stunde kam dann endlich Lederschürzenträger Otto Höpfner mit seinem Blauen Bock - Unterhaltung auf höchstem Niveau.
Damit man wußte, was die Fernsehmacher für uns vorgesehen hatten, gab es immer sonntagmorgens das Programm der kommenden Woche zum Mitschreiben; man stelle sich das vor…! Das TV-Programm umfasste anfangs nur wenige Stunden am Abend. Tagsüber gab es ein Testbild mit aktueller Schlagermusik (West) unterlegt. Um 14 Uhr sendete der NWDR immer einen Kinofilm als Testsendung; ich konnte es kaum fassen – jeden Tag ein Westfilm! Der klare, störungsfreie Klang des TV-Gerätes half erheblich, Vater zu überzeugen, nun endlich auch ein UKW-Radio zu kaufen; seitdem hatten wir auch einen rauschfreien Rundfunkempfang.
Eines Tages brachte mein Bruder eine etwa A5-große Folie aus Hettstedt mit nach Hause, die vollständig mit bonbonfarbigen Schlieren marmoriert war. Diese Folie sollte an die Schutzglascheibe des Fersehgerätes angedrückt werden und im Handumdrehen würde aus dem öden Schwarz-Weiß- ein Farbfernseher. Es war d e r Brüller. Diese bunte Folie klebte zwar, aber das sowieso schon flaue, verrauschte und geisterhafte Bild wurde noch mieser. Etwas ähnlich Kurioses war die »Betrachtungshilfe mit Vergrößerungseffekt«, ein riesiger, schwerer Glasquader. Dieser mußte zunächst mit etwa drei Litern Wasser gefüllt und dann vor dem Gerät postiert werden. Dazu war es erforderlich, mit Hilfe von Büchern und Brettern, in der richtigen Höhe eine Standfläche für den Quader zu errichten (allerdings gab es auch fertig montierte Haltestäbe). Das Glas-Wasser-Monstrum sollte das postkartengroße Bild vergrößern. Das gelang. Das Fernsehbild war furchtbar verzerrt – nun konnte man überhaupt nichts mehr erkennen; es war, als schaute man durch ein Goldfischglas oder durch Schuhmacher Cain’s Schusterkugel.
Kühlen & Waschen
Da es keinen Kühlschrank gab und damit die Kühlmöglichkeiten sehr beschränkt waren, wurden verderbliche Lebensmittel in den 50ern nahezu täglich frisch eingekauft. Wir bewahrten diese im Keller auf dem Fußboden auf. Nicht ganz so empfindliche Lebensmittel standen auf Regalbrettern, ebenfalls im Keller. Ansonsten diente auch noch das Feuerungsloch des Ofens als kurzzeitige Kühlmöglichkeit – ein feuchtes Tuch vor der Öffnung sorgte für einen kühlenden Zug.
Wir hatten in der Waschküche zwar noch einen alten, innen mit Zinkblech ausgeschlagenen Eisschrank stehen, aber der eignete sich nicht mehr zur Aufbewahrung von Lebensmitteln und so diente er als Werkzeugschrank.
Der kühlschranklose Zustand erhielt sich bis 1964. In diesem Jahr wurde richtig zugeschlagen und neben dem Kühlschrank, Kohle- und Elektroherd auch gleich noch eine Waschmaschine gekauft.
Es war eine hölzerne Bottich-Waschmaschine mit Elektromotor (letzteres durchaus keine Selbverständlichkeit). Bevor sie benutzt werden konnte, mußte ‑wie bei einer hölzernen Waschwanne- Wasser eingefüllt werden, damit erst einmal das Holz aufquellen kann und die ganze Sache dicht wird. Erst danach wurde das im Waschkessel bereitete, heiße Waschwasser eingefüllt.
Das aktive mechanische Element der Waschmaschine war ein Zink-Kreuz mit am Ende eingelassenen Rundstäben welches sich je eine halbe Umdrehung rechts- und eine halbe Umdrehung linksherum drehte. Die Waschzeit ergab sich aus dem Bauchgefühl der Mutter. Spülen erfolgte wie bisher in der hölzernen Waschwanne. Trotz der Primitivität stellte die Maschine eine erhebliche Arbeitserleichterung dar, brauchte doch Mutter nicht mehr jedes Stück auf dem Waschbrett zu rubbeln und vermied ab dato wundgescheuerte Fingerknöchel.
Heizen & Kochen
Zur Speisenzubereitung und zum Heizen wurde ein Kohleherd, eine sogenannte Kochmaschine, genutzt, die nahezu ganzjährig in Betrieb war. Die Herdplatte wies drei Feueröffnungen auf, die mit einmal fünf und zweimal drei Herdringen abgedeckt waren. Durch Aufnehmen und Ablegen der Ringe konnte die Temperatur am Boden des Topfes oder der Pfanne grob geregelt werden. An einer Herdseite befand sich die sogenannte Blase, eine etwa fünf Liter fassender und in den Rauchabzug hineintauchender Behälter; auf diese Weise hatte man ständig Warmwasser zur Verfügung. Die Backröhre war im Winter wichtig, sie wurde geöffnet und man konnte seine beim Schlittenfahren unterkühlten und durchnässten Füße erwärmen. Musste ich winters füh zur Schule, hatte Mutter bereits die auf der heruntergelassenen Klappe stehenden Schuhe vorgewärmt.
Im Obergeschoß auf dem Treppenpodest, dem sogenannten Saal, stand eine Grude. Das war ein etwa ein mal anderthalb Meter großer auf Beinen stehender Eisenkasten, auf dessen Boden und unter einem Gitterrost glühender Grudekoks ausgebreitet war und der über weit mehr als einen Tag eine gleichmäßige und milde Wärme entwickelte. In ihr konnten Speisen sehr langsam gegart oder fertige warmgehalten werden. Die Grude hatte kein Abgasrohr und stand direkt unter einem Dachfenster.
Zum Heizen der anderen Räume diente je ein transportabler Kachelofen, der mit Holz, Brikett und Braunkohle geheizt wurde. Da die Wärmespeicherkapazität nicht allzu groß war, wurde der Ofen mehrere Male am Tag angeheizt oder es wurde durch Nachlegen vermieden, daß das Feuer erlischt. Überhaupt hatte ich in meiner Kindheit ständig mit Kühle und Kälte zu kämpfen; niemals war es an allen Orten im Haus gleichmäßig warm, pausenlos mußten Holz und Kohlen nachgelegt und Asche entfernt werden. Brennstoffe wurden nicht angeliefert, sondern direkt beim Kohlehändler in unserer Nachbarschaft gekauft. Sowohl Holz als auch Kohle wurden natürlich auf Bezugsschein verkauft. Die Bezugsscheine trugen ein aufgedrucktes Buchstaben-Paar und unterschieden so zwischen Rohbraunkohle (RB) und Braunkohlebriketts (BB), wobei die Braunkohle oft sehr feucht, sehr groß oder sehr zerfallen oder alles gleichzeitig war, schlecht brannte und demzufolge auch schlecht heizte; Schornsteine versotteten.
Steinkohlenkoks wurde hin und wieder frei verkauft und fortschreitend fast hundertprozentig durch Braunkohlenkoks ersetzt. Kohle und Koks wurden auf einer speziellen Kohlenwaage abgewogen, in mitgebrachte Säcke geschüttet und dann auf dem Handwagen über Katzenköpfe nach Hause gerattert. Brennholz wurde kastenweise verkauft. Das bedeutet, daß in einen leeren Holzrahmen (vielleicht 50 x 75 cm) aufrecht stehende Holzscheite gesteckt wurden, bis er ausgefüllt war. Der Kohlehändler guckte immer etwas säuerlich, wenn man versuchte, jeden noch so kleinen Spalt mit einem dünnen Scheit zu stopfen. Relativ viel ausgemustertes Holz aus dem Schacht-Ausbau erhielten die Bergleute als Deputat. Das wurde mit der Schrotsäge (Schweinsrücken) gleich auf dem Gelände des Schachtes zurechtgeschnitten und dann auch wieder mit dem Handwagen nach Hause gebracht. Die Asche aus den Öfen wurde in einen kleinen, etwa 1–2 Kubikmeter fassenden, ummauerten Raum (genannt die Asche) geschüttet. War sie gefüllt, wurde der Inhalt mit dem Handwagen auf die Müllkippe (ebenfalls Asche genannt) am Grift gebracht. Von Siersleben, Hübitz und Augsdorf etwa gleich weit entfernt, luden alle Einwohner hier ihre Asche und sonstigen Abfälle ab. Zur Leerung unserer Asche waren drei Fahrten notwendig, die etwa einen halben Tag in Anspruch nahmen.
Man sieht, ohne Handwagen lief in dieser Zeit nichts; fast jede Familie hatte mindestens einen (meist) kleineren und oft auch noch einen großen Wagen auf dem Hof stehen. Mancher Dorfbewohner spannte zusätzlich noch seinen starken Bello in ein Geschirr – japsende, eifrig zerrende Hunde waren mir ein gewohnter Anblick.
Wasserversorgung
Bis Anfang der 60er wurde das Wasser mit Pumpen (Plumpen) aus Brunnen gefördert. In der Regel stand auf jedem Grundstück eine Pumpe über einem Brunnen. Ich erinnere mich lediglich an drei öffentliche Pumpen in Siersleben: Je eine auf dem Hof der Alten- und der Neuen Schule und eine Dritte am Dorfteich; es waren aber viel mehr. Unser eigener Brunnen, von Vater kreisförmig aus Schiefer geschichtet, befand sich in einer kleinen Brunnenkammer im Inneren des Hauses und war elf Meter tief. Es wurden immer zwei Wassereimer abgepumpt, die auf einem kleinen Holzgestell ‑einer sogenannten Wasserbank- im Hausflur standen. Entnommen wurde das Wasser mit einem Nösel, ein geeichtes Aluminiumgefäß (0,5 Liter), das an seinem langen Stiel im Eimer hing. Solche Nösel wurden auch von Milch-Chmura in der Hettstedter Straße beim Milchverkauf in verschiedenen Größen verwendet (0,25 / 0,5 / 1) Liter.
Warmes Wasser wurde aus der Blase entnommen oder extra auf der Kochmaschine erhitzt. Verbrauchtes Wasser wurde vor der Haustür in die Straßengosse geschüttet. Als dann eine zentrale Wasserversorgung installiert worden war, haben wir unseren Brunnen mit Asche aufgefüllt und verschlossen.
Bezugskarten
Die gesamte Kindheit und fast die ganze Jugend hindurch gehörten Lebensmittel- und andere Bezugskarten zum täglichen Leben. In der Praxis bedeutete das, daß zwei parallele Preissysteme existierten. Die staatliche Handelsorganisation (HO) verkaufte neben höherwertigen Waren auch die ganz normalen Allerweltsartikel und Lebensmittel ‑sofern überhaupt vorrätig- ohne Einschränkungen. Die Konsumgenossenschaft verkaufte sowohl rationierte als auch freie Waren und Lebensmittel .
Für haargenau den gleichen Artikel lagen die Preise der HO um das Doppelte bis zum Drei‑, Vierfachen und noch mehr über dem Preis des Konsums beziehungsweise der Privatgeschäfte, die auch keine HO-Waren führten.
Jedes Familienmitglied erhielt monatlich seine eigene Lebensmittelkarte, wobei der Beruf entschied, wieviel Gramm Fett, Zucker, Milch und Fleisch einem zustanden. Die monatlichen Mengen waren nicht konstant, sondern konnten variieren – je nach aktueller Versorgungslage und Jahreszeit.
Die Lebensmittelkarte bestand aus kleinen Marken, auf denen Werte aufgedruckt war, z.B. ”Fleisch – 125 Gramm” oder ”Zucker – 200 Gramm”. Damit sie einigermaßen fälschungssicher waren, wurde, Geldscheinen ähnlich, ein Sicherungsmuster eingedruckt. Im Geschäft wurden diese Marken mit einer Schere von der Karte abgeschnitten und abends vom Geschäftsinhaber oder Verkäufer revisionssicher auf Papier aufgeklebt.
»Eine Bockwurst, der junge Herr? Ja gerne doch – HO oder Konsum?”
”Gonsumm”
”Macht 80 Pfennig, der junge Herr – und 100 Gramm Fleisch” [gemeint sind Marken]
So ähnlich lief der Dialog an einer Bockwurstbude oder in einer Gaststätte ab. Denn auch in Gaststätten wurde bei Speisen nach Lebensmittelkarten gefragt, wenn es sich nicht um HO-Gaststätten (HOG) handelte. Gott sei Dank gab es Bier ohne Karten.
Hätte man keine ”100 Gramm Fleisch” auf der Lebensmittelkarte entbehren können oder wollen, müßte man vielleicht 2,40 Mark HO-Preis bezahlen. Es kam auch oft vor, daß irgendeine außerplanmäßige Lieferung, beispielsweise ein Pfund Fisch, angeboten wurden für ”250 Gramm Fett” oder »Abschnitt A3«. Untertage tätige Bergleute bekamen eine Karte für Schwerstarbeiter. Diese Kategorie war, glaube ich, die Üppigste, die es in der DDR gab. Obendrauf erhielt man ein Monats-Deputat an ”Bergarbeiter-Trinkbranntwein”, wie der Schachtschnaps offiziell hieß.
Darüber hinaus wurden noch andere Berechtigunsscheine, sogenannte Punktekarten ausgegeben, die aber länger als einen Monat gültig waren. Diese berechtigten zum Kauf von Industriewaren. In erster Linie waren das Bekleidung, Textilien und Schuhe. Für Brenn- und Heizmaterial, dem sogenannten Hausbrand, waren auch Karten erforderlich. Je nach Situation, zum Beispiel der Familiengröße, dem Gesundheitszustand u.a. wurde noch nach Grund- und Zusatzkarten unterschieden. Beispielsweise konnte man im Schaufenster bei Leder-Raabe Schilder sehen, auf denen etwa zu lesen war »Lederschuhe 10 Mark (20 Pkt.)«. Man erhielt also für 10 Mark ein Paar Schuhe und mußte dazu 20 Punkte von seiner Punktkarte abschneiden lassen. Waren die Punkte aufgebraucht, bekam man die Schuhe überhaupt nicht oder mußte 100 Mark bezahlen, je nach Vorgabe der übergeordneten Stellen. Ehemalige NSDAP-Mitglieder waren vom Bezug von Karten ausgeschlossen.
Gott sei Dank bekamen die Bergarbeiter kostenlos (!) feste und hohe ‑die sehr dicken Ledersohlen mit Zwecken beschlagen- Arbeitsschuhe, die oft noch eine eiserne Kappe um Hacken und Schuhspitze aufwiesen. Waren die Schuhe zerschlissen, wurden Zwecken und Kappen entfernt und aus Panzertretern wurden (fast) normale Schuhe.
Nicht mit Punkten kaufen konnte man höherwertige Artikel, beispielsweise optische Geräte. Wenn man eine Kamera oder Feldstecher kaufen wollte, mußte man seinen Personalausweis vorlegen und die Personalien wurden zusammen mit der Gerätenummer erfaßt. Das sollte verhindern, daß die Geräte, deren Hersteller (Carl Zeiß Jena; Pentacon Dresden) noch aus Vorkriegszeiten einen guten Namen hatten, auf dem Schwarzmarkt landeten und im Westen für mehr Westgeld verkauft wurden, als man an DDR-Mark im Laden bezahlt hatte.
Diese Philosophie unterschiedlicher Preissysteme wurde ja in den 70er Jahren wieder eingeführt in Form der Exquisit- und Delikatläden; nicht zu reden von Forum-Scheck und Intershop.
Einkauf & Vorratshaltung
Zum Einkaufen benötigte man immer irgendwelche Gefäße, denn abgepackte Ware war nicht selbstverständlich. Marmelade, Butter, Bonbon, Mehl, Zucker, saure Gurken, Senf, Essig – wenige Artikel befanden sich in einer Verkaufspackung, wie zum Beispiel Malzkaffee. Je nach Ladenausstattung wurden die verlangten Waren Kisten, Säcken, Eimern, Gläsern und Fässern entnommen oder aber es standen in die Ladeneinrichtung integrierte Gefäße zur Verfügung, aus denen die Waren mittels spezieller Portionierungs-Auslässe entnommen werden konnten. Essig wurde aus Porzellankrügen gezapft, Pflaumenmus, Marmelade und Schmierseife aus dem Pappeimer gekellt und Butter vom 10-Kilo-Block abgestochen. Die gekaufte Ware wurde hauptsächlich in Einkaufsnetzen nach Hause getragen, wobei Bügelflaschen ständig nervten, weil sie sich immer wieder verhedderten.
Einmal sollte ich Senf einkaufen und meine Mutter drückte einen Fünfzig-Pfennig-Schein (ja, das gab es) in ein Steinguttöpfchen – »Vürz’ch Fennije gkrichste zurück«. Ich rannte zu Naumann in der Gartenstraße ‑nie konnte ich normal gehen, nur rennen- und reichte mein Töpfchen über den Ladentisch: »Forn Groschen Mosdrich«. Die Seniorchefin bei Naumann zog den Pumpkolben des Porzellanzylinders -pfff- und drückte ihn wieder zurück ‑pfff‑, senfte mein Töpfchen voll und reichte es mir gefüllt zurück. Sie hielt ihre Hand auf – ich ebenfalls. Sie wollte zehn Pfennig Kauf- und ich vierzig Pfennig Rückgeld – fünfzig Pfennig waren vom Mostrich bedeckt…
Flüssig-Kartoffeln
Alle im Mansfelder Bergbau Beschäftigten erhielten ein monatliches Deputat an steuerbefreitem »Trink-Branntwein für Bergarbeiter«: Anfangs, direkt nach dem Krieg, betrug die monatliche Menge ein Liter für Übertage- und zwei Liter für Untertage-Beschäftigte. Später wurde bei Untertage-Arbeitern nochmals nach Arbeitsaufgabe unterschieden, das bedeutete, die Menge war dann davon abhängig, ob man beispielsweise im Vortrieb, im Abbau, im Ausbau oder als Handwerker beschäftigt war. Durch diese Differenzierung konnten bis zu fünf Liter monatlich zusammenkommen, wobei für den Bezug (in der Verkaufsstelle) Berechtigungsscheine notwendig waren.
Der einfach gebrannte Kartoffelschnaps mit 32% Alkoholgehalt war in Ein-Liter-Flaschen abgefüllt und wurde angeblich Kumpeltod genannt. Daran kann ich mich allerdings nicht erinnern; er hieß ganz einfach Schachtschnaps.
Wie Vieles in der damaligen Zeit war auch Schachtschnaps nur sporadisch zu erhalten. Das hatte zur Folge, daß sich mitunter Bezugsscheine mehrerer Monate ansammelten. Wenn dann irgendwann die ersehnte Tafel »Heute Schachtschnaps« vor dem Ladens stand, sah man die Frauen der Kumpel mit Gefäßen in und vor der Verkaufsstelle. Wenn der Ehemann als Häuer vor Ort arbeitete und ihm fünf Liter zustanden, dann benötigte seine Frau bereits einen Wassereimer; der Literpreis betrug achtzig Pfennig. Die gefüllten Eimer wurden vorsichtig nach Hause transportiert, wobei ein Geschirrtuch das Ganze abdeckte – nicht etwas aus Scham, sondern, damit nichts überschwappt, die Straße nicht bekleckert wird und somit keine betrunkenen Hunde herumirren.
Weshalb wurden Gefäße mitgebracht? Die geleerten Flaschen verblieben im Geschäft. Das Leeren der Flaschen in die Gefäße geschah, indem die Verkäuferin zwei Flaschen gleichzeitig ergriff und mit ein, zwei kurzen, heftigen Umdrehungen um deren Längsachsen in ihnen einen Strudel erzeugte; innerhalb zweier Sekunden – grgrgrggg gurgelte der Flascheninhalt in den Eimer.
Wenn ich mich richtig erinnere, war der Verkauf von Schachtschnaps in Privatläden nicht erlaubt; wir bezogen unseren immer von der Konsum-Verkaufsstelle im Erdgeschoß von Heklau’s Kino – übrigens erster Selbsbedienungsladen Sierslebens.
Schachtschnaps wurde nur ganz selten eikel (also pur) hinuntergewürgt. In unserem Küchenbuffet, zeittypisch Gelsenkirchener Barock, stand eine ganze Batterie kleiner Glasfläschchen; ihr Inhalt: Künstliche Likör-Aromen, die in Riechers’ Drogerie billig und zu jeder Zeit zu erstehen waren. Jedem Fläschchen war ein Klebe-Etikett für eine normale 0,7‑Liter-Flasche beigelegt, das mit dem Aufdruck »Hausmarke« und der Geschmacksrichtung wie »Abtei«, »Pfefferminz«, »Kirsch«, ”Aprikose” und Ähnlichem versehen war. Ein Fläschchen Essenz, etwas Zucker und kräftiges Schütteln reichten aus, um farblosen Schnaps in gelben, roten oder grünen Likör zu verwandeln; die nächste Feier kam bestimmt.
Flüssig-Rüben
Der Beginn der Zuckerrübenkampagne führte auch in den privaten Haushalten zu einer Resteverwertungs-Aktivität, die der Grundversorgung der Familie diente: dem ”Saftkochen”. Wir Kinder sammelten von den abgeernteten Rübenschlägen Exemplare, die nicht den Weg auf den Erntewagen gefunden hatten. Nun ja, mitunter fielen auch Rüben von den Wagen, auf denen sie zur Zuckerfabrik nach Helmsdorf gebracht wurden, zu Boden.
Zu Hause wurden die Rüben im großen Holzbottich, der sonst der Großen Wäsche diente, mit einer Wurzelbürste sorgsam gesäubert und dann zuerst mit einem Beil und danach mit einem Wiegemesser geschnitzelt. Die Rübenschnitzel kamen anschließend in den Waschkessel und wurden hier im heißen Wasser gekocht, so daß sich der Rübenzucker löste. Der beim Kochen enstehende Geruch war dabei unangenehm dumpf. Nach ein, zwei Stunden wurden die Schnitzel herausgenommen und der Sud wurde unter stundenlangem langsamen Rühren auf kleiner Flamme weiter gekocht und so immer mehr eingedickt, dabei sollte der Zucker nicht auskristallisieren und durfte auch nicht am Kesselboden anbrennen. Am Ende des Tages hatte man schließlich 20 bis 30 Liter dicken schwarzbraunen Rübensirup. Der ”Saft” wurde in Gläser abgefüllt, erbarmungslos auf den Frühstückstisch gestellt und auf Pausenbrote geschmiert. Vater bekam auf seine ”Schachtbemm’ ” allerdings keinen Saft, sondern Wurst und Schinken, so wie alle Bergleute.
Kartoffelstoppeln
Eine andere Art von Resteverwertung bestand im Kartoffelstoppeln, das heißt, daß wir abgeerntete Schläge nochmals abkartoffelten, um beim Lesen übersehene Knollen zu finden. Eigentlich wäre die Erlaubnis des Grundeigentümers notwendig, welche aber fast niemals gegeben worden wäre. Da man dies wußte, fragte man folgerichtig erst gar nicht nach.
Zum Stoppeln benötigte man vor allen Dingen scharfe Augen, um Personen, die am Rain auftauchten als gefährlich oder als harmlos einordnen zu können. Ferner brauchte man noch einen Handwagen, ein Zugseil, einen oder zwei Kartoffelsäcke, einen Karst und einen Korb. Der Acker wurde Furche für Furche abgelaufen und durchgekarstet, um die nicht gelesenen Kartoffeln aufzuspüren. Im Verlaufe eines Nachmittages bestand durchaus die reelle Chance etwa einen Zentner Kartoffeln, also einen Sack voll, zusammenzubekommen – aber es war nicht leicht. Man ließ den Handwagen immer am Rain stehen und trug die Kartoffeln im Korb dorthin, den Wagen über den weichen, lockeren Acker zu ziehen, war sehr kräftezehrend für einen acht‑, zehnjährigen Jungen.
Die meist kleinen Stoppelkartoffeln dienten in erster Linie dem Verfüttern an das obligatorische Hausschwein, dessen Schlachtung immer im November bevorstand.
Viel Vieh – Viel Ähr’
War die Sommerschlacht geschlagen, begann für uns die Zeit des Ährenlesens. Wir hängten uns große Beutel über unsere schmalen Schultern und füßelten über die abgeernteten Getreidefelder, immer darauf achtend, die nackten Füße nicht auf, sondern zwischen die Getreidestoppeln zu setzen. Egal, von wem die Stoppeln stammten (Einzelbauer oder Genossenschaft) – sie schmerzten, wenn man darauf trat.
Die meisten Bauern arbeiteten mit einem Mähbinder, entweder mit dem eigenen oder einem von der MAS/MTS ausgeliehenen. Auch hier mußten die Garben noch zu Hocken zusammengestellt werden.
Meinen ersten Mähdrescher sah ich auf dem Schlag zwischen Mühlweg und Eislebener Straße arbeiten. Es war ein C4 – ein Stalinez 4. Alle Dorfjungen liefen neben dem Wunderding her, das das fertig ausgedroschene Getreide seitlich herausblies und hinten in regelmäßigen Abständen Strohballen fallen ließ.
Es war keine schwere, aber langwierige Arbeit, die Ähren vom Acker zu lesen und den Beutel damit zu füllen. War der endlich voll, wurde er nach Hause gebracht, wo der Beutelinhalt nach manuellem Dreschen mit einem kurzen Knüppe- in einen Sack umgefüllt wurde. War dieser nach vielen Tagen Sammeltätigkeit gefüllt ( was meist nicht gelang), ging es damit zur Mühle. Man hatte zwei Mühlen zur Auswahl, Eine, an deren Fassade noch das mit Teer geschriebene Wort »Dampfmühle« zu lesen war, obwohl natürlich längst Elektromotoren mühlten; die andere Mühle war eine Bockwindmühle, die ich bereits oben erwähnte. Müller standen ja seit Jahrhunderten im Ruf, Betrüger zu sein und ihr Handwerk wurde zu den unehrenhaften Berufen, wie Henker oder Abdecker gezählt. Dass unsere beiden Dorfmüller Betrüger waren, glaube ich nicht. Je nachdem, was man zum Mahlen brachte, bekam man das dem gebrachten Getreide entsprechende Mahlgut, Schrot und/oder Kleie, vermindert um den Mahllohn zurück. Beides wurde dem Viehfutter beigemengt. Mehl ließ man sich, wenn ich mich richtig erinnere, nicht aushändigen.
Pferde statt Trecker
Natürlich spielten auch Pferde in einer Kindheit auf einem Vorharz-Dorf immer eine Rolle. Irgendwie taten mir diese großen Tiere immer leid, wenn sie abgearbeitet im Geschirr gingen und ihre Riesenköpfe im Takt nickten.
Die Straßen in unserem Dorf waren mit Katzenköpfen oder Mansfelder Schlacken gepflastert. Lagen diese schon einige Jahrzehnte im Bett, war Ihre Oberfläche derart glatt, daß man auch als Fußgänger, wenn nicht gerade Schwierigkeiten, so doch zumindest ein potentielles Problem mit Ausgleiten hatte.
Um wieviel mehr waren diese Straßen tückisch für Pferdehufe. Mehrfach sah ich Pferde, die keinen Halt mehr fanden, auf der Straße liegen und verzweifelt versuchten, wieder auf die Beine zu kommen. Das Dramatische an der Situation war die Angst der Tiere. Wenn sie sich nichts brachen, konnte ihnen mit einer großen, untergelegten Plane geholfen werden, wieder in die Hufe zu kommen.
Sommers, wenn der Tag staubig und heiß war, sahen wir oft, wie die Pferde zum Dorfteich geführt wurden, um sie abzukühlen und sich vollsaufen zu lassen. Sie standen dann wie Denkmäler im Wasser und fühlten sich sichtlich wohl. Einzig die Zugtiere von Bauer Dittmar, der auch eine Gaststätte betrieb, waren nie am oder im Teich zu sehen – er besaß keine Pferde, denn seine Zugtiere waren zwei Ochsen. Es gibt in dem zweiteiligen DEFA-Film »Ernst Thälmann« eine Szene, die im Mansfelder Land spielt und in welcher der Protagonist Günther Simon mit einem Ochsengespann-Führer redet. Also, der Führer war nicht Bauer Dittmar, aber die Ochsen – das waren Seine.
Großvaters Pferde
Oft bin ich mit meinem Großvater und dessen Gespann mitgefahren. Sympathisch fand ich es, daß, wenn er abends auf den Hof zurück kam, immer zuerst die Pferde tränkte (das Wasser wurde in Holzeimern von der Plumpe geholt) und ihnen dann Futter und Hafer in Raufe und Trog schüttete. Dazu erklärte er mir, der einstige Halberstädter Kürassier: »Mergke Diche das mei Junge: erschd ’s Ferd – denn d’r Reider.»
Waren Pferde und er versorgt, genehmigte er sich sein Feierabend-Pfeifchen mit dem schönen, bemalten Porzellankopf. Über das Mundstück der Pfeife hatte er den Flaschengummi einer Bier-Bügelflasche geschoben. Die Pfeife zündete er sich zu Hause immer mit einem Fidibus an. Wöchentlich einmal schnitt er sich ein Bündel zunächst mit einem kleinen Beil und dann mit einem Messer zurecht. Wozu Streichhölzer verschwenden, wenn doch im Küchenherd sowieso immer ein Feuer brennt. »Nischt unnütze« war eine seiner Philosophien. Eine andere lautete: »Wenn’de dich nich sadd essen gannst, gannst’de dich aach nich sadd leggen.« Großvater kümmelte im Wortsinne gerne Einen, dergestalt, daß er eine Literflasche Deputatschnaps mit einer Handvoll Kümmel ansetzte – damit der ”wenichstens nach was schmeggt.” Und damit er auch richtig feuerte, streute er vor dem Trinken eine Prise Pfeffer in sein Glas: »Schnaps muß zwaij Mal brenn’.« Richtig, Opa.
Wie schon gesagt, nahm mich Großvater des öfteren auf seinem Gespann mit. Einmal ging eine Fahrt zum Bahnhof nach Hettstedt. Großvater kümmerte sich ewig lange um seine Ladung, so daß ich die Geduld verlor und mich zu Fuß auf den fünf Kilometer langen Heimweg machte – ohne ihm Bescheid zu geben. Opa durchsuchte stundenlang die Gegend, um dann am Abend meiner Mutter die Mitteilung zu überbringen, daß ich verschwunden sei. Hui – was gab es den Wanst voll.
Hin und wieder gab es sonntags eine Ausfahrt mit dem viersitzigen, weich federnden Landauer. Diese Ausflüge führten zum Süßen See oder die Klausstraße hinauf nach Saurasen, zur Klippmühle, zum Vatteröder Teich. Am Reiseziel gab es immer Brause oder ein Malzbier für mich und ein Bierchen für meine Eltern und Opa.
Eine Kutschfahrt führte uns in das Krankenhaus Hettstedt, in das meine Großmutter eingeliefert worden war. Sie lag in einem damals üblichen großen Krankensaal mit vielleicht zehn Betten. Wenige Tage nach ihrer Entlassung starb sie zu Hause. Mein Großvater hat gewußt, wie es um sie stand: Kurz bevor sie starb sagte er zu meiner Mutter: “Mutter gefällt mir gar nicht, sie ist so aufgekratzt und riecht nach Messing.”
Kochs Pferde
In unserer Nachbarschaft hatte der Kohlenhändler Koch seinen Hof. Mit dessen Pferden hatte ich immer besonderes Mitleid. Koch mußte seine Brennstoffe immer vom Bahnhof abholen. Für den Transport standen ihm einige Pferde zur Verfügung; ob er einen Trecker oder ähnliches besaß, weiß ich nicht mehr. Seine Tiere quälten sich, indem sie fast immer mehrere gekoppelte Wagen die etwa zwei Kilometer vom Bahnhof zu seinem Kohlehof ‑vorbei an unserem Haus- schleppten.
Wenn ein Kohlewaggon der Reichsbahn auf dem Bahnhof eintraf, mußte dieser so schnell wie möglich entladen werden, um die nach Stunden zählende Gebühr der Reichsbahn (Standgeld) so gering wie möglich zu halten. Zwei, drei kräftige Burschen, die immer kurzfristig angeheuert werden mußten, halfen dem Kohlenhändler, indem sie den Waggon per Hand mit einer Kohlegabel entluden. Koch, dem ein Arm amputiert worden war, arbeitete aktiv mit, indem er sich das Ende des Gabelstiels unter die intakte Achsel klemmte, so daß die vollen Gabeln nur so über die Waggonwand flogen. Bagger? – Was ist das?
Waren die Pferdewagen gefüllt, galt es, die Ladung in kürzester Zeit zum Kohlenhof zu bringen, die Wagen zu entladen und wieder zurück zum Bahnhof zu hetzen. Noch heute sehe ich diese dampfenden Pferde vor mir. Aber sie hatten natürlich auch gute Stunden, wenn sie im Garten von Kohlenkoch grasten – dann dampfte nur ihr gelbes Gebiß.
Ein böser, böser Nachbarsjunge animierte mich einmal, über die Deichsel eines angehängten kleineren Wagens (den wir Eselswagen nannten) zu flanken. Und so kam es, daß dieser mit seinem Rad über die Kuppe meines rechten Daumens fuhr. Dessen Nagel blieb fortan mein ganzes Leben lang verkrüppelt. Weil er nie mehr mit seinem Nagelbett verwuchs nervt er mich bis heute. Ständig wurd er gestoßen, gequetscht, nach oben abgewinkelt, abgebrochen, eingerissen, eingefärbt von Ölfarben, Ketchup, Salz- und Sandkörnern, Staufferfett, Gipsbrei, Obstfleisch, fettem Speck und tausend weiteren Stoffen unterwandert. Na ja, es gibt Schlimmeres.
Frankes Pferde
Gern trieb ich mich auch in der Nähe der Dorfschmiede herum; es faszinierte mich, wenn die Funken des Schmiedefeuers stoben und Eisen sich scheinbar mühelos verformen ließ. Schmied Franke hatte nichts dagegen, wenn wir Dorfjungen ihn bei seinen Arbeiten zusahen. Besonders das Beschlagen von Pferden war für uns interessant. Es war staunenswert, mit welch stoischer Ruhe die Pferde die Prozedur über sich ergehen ließen. Da gab es kein nervöses Tänzeln, kein Aufsteigen, keine Bissigkeit und kein Schlagen – egal ob geraspelt und gesäubert oder das Eisen angepaßt und schließlich genagelt wurde.
Von Schmied Franke lernte ich, daß Huf niemals gleich Huf ist, auch nicht bei ein und demselben Pferd, und erst recht nicht Eisen gleich Eisen; ich glaube, mindestens zwei Dutzend unterschiedlichster Hufeisenarten konnte er benennen.
Nationales Aufbauwerk
In den frühen fünfziger Jahren wurde von der SED-Spitze das Nationale Aufbauwerk (NAW) ausgerufen. Das Ziel bestand vordergründig in der Beseitigung der Kriegsschäden durch freiwillige, unbezahlte Arbeit.
Das NAW fand erstaunlich viel Resonanz bei der Dorfbevölkerung, obwohl keine Kriegsschäden zu beseitigen waren; es gab keine. Viele Einwohner opferten Freizeit, Urlaub und Wochenenden, um gemeinnützige Bau – und Gärtnerarbeiten zum Wohl des gesamten Dorfes auszuführen.
So bekam zum Beispiel der Dorfteich eine aus Betonfertigteilen bestehende Uferbefestigung, das Spritzenhaus für die Feuerwehr wurde renoviert, ein Schulungs- und Versammlungsraum für die Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes wurde im Vereinszimmer von Dora’s Kneipe eingerichtet und ähnliche Objekte mehr.Es wurden Bänke repariert, angefertigt, gestrichen, die Bus-Wartehalle neben Fleischauer gebaut, öffentliche Räume wurden renoviert oder ausgebaut. Auch größere Bauvorhaben wurden ausgeführt, ich erinnere mich da an den Bau des Sportstadions »Glück-Auf-Kampfbahn« am Mühlweg mit Stehtribüne und Umkleidekabinen. Diese Sportstätte wurde 1955 eingeweiht. Materielle und finanzieller Unterstützer war immer das Mansfeld Kombinat mit seinen Betrieben – vor allem der Thälmann- und der Brosowski-Schacht.
Wasser für Siersleben
Auch der Bau einer zentralen Trinkwasserversorgung war ein NAW-Projekt, welches von allen Dorfbewohnern getragen wurde. Die Schacht- und Installationsarbeiten zogen sich über ein ganzes Jahrzehnt hin, wobei die Anwohner der Klostermansfelder- und Friedrichstraße nach den Bewohnern der »Siedlung« als Erste einen Anschluß erhielten. Die Speisung der Anlage erfolgte durch einen Hochbehälter auf der Niewandtschächter Halde.
Es gab bis dahin keine zentrale Wasserversorgung. Ausnahmslos alle Einwohner wünschten sich einen Wasserhahn in der Wand, um endlich den Gang zur »Plumpe« der Vergangenheit angehören zu lassen.
Ein Kuriosum stellte die Wasserversorgung der Familienhäuser dar. Im obersten Geschoß war ein größerer Wasserbehälter untergebracht, für dessen Füllung abwechselnd je eine Familie verantwortlich war. Das Wasser hierzu wurde per Handkurbel aus dem Brunnen nach oben gefördert und über Bleirohre auf je eine Zapfstelle pro Flur und Etage verteilt.
Im Gegensatz zu manchen anderen Haushalten, deren Pumpe meist auf dem Hof installiert war, stand unsere Pumpe im Haus. In einem kleinem Verließ, aus einem 11 Meter tiefen, mit Schiefer ausgemauerten Brunnenschacht, pumpten wir unser Grundwasser ab. Die einzige Zapfstelle unserer neuen Wasserleitung befand sich in der Waschküche. Wenn meine Mutter in der Küche Wasser benötigte, brauchte sie nur noch durch zwei Türen, über einen Flur und durch eine weitere Tür in die Waschküche zu gehen, den Eimer zu füllen und zurück zu tragen. Dabei mußte sie achtgeben, daß der unter dem Wasserhahn stehende Topf für das Tropfwasser nicht verschoben wurde, denn ein Ausguss unter dem Wasserhahn war noch nicht vorhanden. Erst einige Zeit später gelang es Vater einen alten, halbrunden Ausguß aus Gußeisen zu besorgen und zu installieren, wobei »installieren« etwas hochgestochen ist, da ein Pressluftschlauch vom Abfluss einfach durch die Hauswand hindurch auf den Gehweg führte.
Zu dieser Zeit war es üblich, alles im Haushalt anfallende Schmutzwasser (und das war eigentlich nur Abwasch- und Aufwischwasser) in die Gosse auf der Straße zu schütten. Ganzjährlich rann Wasser in dieser Gosse, die die Verlängerung des Straßengrabens zwischen Siersleben und Thondorf war. Nach Regen oder während der Schneeschmelze wurde diese Gosse zu einem reißenden Strom – ähnlich dem Rhein bei Schaffhausen. Die Kreuzung (die auch immer nur so genannt wurde) am Dorfplatz wurde von diesem Wasser ständig naß gehalten. Die Konstellation Mansfelder Schlackensteine als Straßenbelag und im Gossenwasser enthaltene Seifenlauge lernten vor allem Zweiradfahrer schätzen und lieben.
Tote im Park des Friedens
Ein NAW-Projekt ging gründlich in die Hose: An unseren Schulhof grenzte der schon seit Jahrzehnten nicht mehr benutzte alte evangelische Friedhof unserer Kirche St.Andreas. Da der evangelische Pastor schon traditionell zur Zielperson von SED-Schikanen zählte, glaubte ein übereifriger Funktionär des Dorfes, auch sein Scherflein beisteuern zu müssen. Und so kam es, daß unserer Schule das NAW-Projekt »Park des Friedens« übergeholfen wurde, welches darin bestand, den Friedhof »umzugestalten«. Erschreckend unkritisch und ohne nachzudenken, begannen Schüler und Lehrer irgendwann mit der »Umgestaltung«. Mit Spaten, Axt und Säge begingen wir die Straftaten »Friedhofsschändung«, »Hausfriedensbruch« und »Störung der Totenruhe«. Wir »gestalteten« nicht nur Gebüsch, Sträucher und Grabsteine um, sondern beförderten auch Gebeine zu Tage, die wir auf einem Haufen sammelten…
Es gab einen unglaublichen Skandal im Dorf, bei dem es auch zu Handgreiflichkeiten kam. Erst später wurde bekannt, daß die Mehrzahl unserer Lehrer sich bereits vor dieser Provokation davon distanziert hatte. Sie waren aber eben auch keine Helden und hatten nicht den Mut, öffentlich dagegen vorzugehen. Dem damaligen äußerst couragierten Pastor Storck und einigen Mitgliedern seiner Gemeinde war es vorbehalten, diesem Spuk ein Ende zu setzen.
Die freigelegten Gebeine wurden erneut bestattet, Grabsteine wurden wieder neu gesetzt und der materielle Schaden, zum Beispiel die durchbrochene Friedhofsmauer zum Schulhof hin, durch Instandsetzung beglichen. Ob es ein juristisches Nachspiel gab, ist mir nicht bekannt.
Damit aber das Projekt »Park des Friedens« nicht ganz den Bach hinunter ging, wurde an anderer Stelle eine entsprechende Grünanlage geschaffen. Und weil diese ein wenig mickrig auszufallen drohte, wurde kurzerhand noch das ganze Wohngebiet Familienhaus / Schlafhaus in ”Park des Friedens” umbenannt.
Von der Sowjetunion lernen
Sie waren ja geniale Menschen – die sowjetischen Neuerer. Sie waren so schlau, daß man einfach nicht umhin konnte, ihrem leuchtenden Beispiel zu folgen. Die SED-Presse in den fünfziger und sechziger Jahren propagierte unermüdlich Neuerungen der sowjetischen Klassenbrüder. Jeder war aufgerufen, wie Bassow seinen Arbeitsplatz aufzuräumen, wie Kirow die Arbeit vorzubereiten und wie Stachanow 100 Tonnen Kohle zu fördern.
Aus der großen Sowjetunion kamen neue Methoden für Dreher, da wurden Werkzeuge vor der Arbeit in der richtigen Reihenfolge auf der Werkbank bereitgelegt und viele ähnliche umwerfende Methoden. Da gab es weiter die Irkutsker‑, Smirnow‑, Gaganowa‑, Santalow‑, Nowoshilow‑, Slobin‑, Tschutkitch‑, Nina-Nasarowa‑, Mitrofanow‑, Kowaljow‑, Lydia-Korabelnikowa‑, Odessa‑, Iljitschowsk- und die Saratow-Methode. Ach so, ja – also, die Arefjewa-Initiative wollen wir mal nicht vergessen. Soviel Zeit muß sein. Die Funktionäre waren wie besoffen, so wie heute (2021) einige Gute.
Man fragte sich, wie die Arbeiter außerhalb der ruhmreichen Sowjetunion eigentlich bisher arbeiteten; wahrscheinlich rannten sie ziellos an ihren Arbeitsstätten hin und her, stolperten über nicht ordnungsgemäß aufgeräumtes Werkzeug oder faßten es gar an den falschen Enden an. Sie warteten händeringend auf die brüderliche Hilfe der sowjetischen Neuerer.
Aber siehe da, auch in der DDR fanden sich große Neuerer, wie der sächsische Häuer Adolf Hennecke (387 % Normerfüllung), die Weberin Frida Hockauf (»Wie wir heute arbeiten, so werden wir morgen leben«) oder der Baubrigadier XYZ (»Meine Hand für mein Produkt«), und dann behauptete noch jemand: »Mein Arbeitsplatz – mein Kampfplatz für den Frieden«, während ein weiterer den »Bereich der vorbildlichen Ordnung und Sicherheit« erfand.
Unsere, die Zentralschule Schule Siersleben, wurde zu dieser Zeit nach obigem Zwickauer Kohle-Häuer umbenannt.
Russenställe
Die noch neuen, fast ungebrauchten Genossenschaftsbauern wurden gehörig belehrt und auf ihre altmodischen Methoden hingewiesen. Kühe (»Rauhfutter verwertende Großvieheinheit »- RGVE) können doch nicht einfach so im Stall stehen. RVGEs brauchen Luft, Licht und Sonne, so die Meinung der Tierzuchtexperten im Zentralkomitee und empfahlen den Bau von Rinderoffenställen.
Eifrig wurde auf den unteren Ebenen der Ratschlag angenommen und überdachte Flächen geschaffen, die keine Wände besaßen – fertig war ein Rinderoffenstall. Die Kühe fühlten sich sehr viel wohler – im Sommer.
Aber bei eisigen Winden, bei Regen oder bei Schneegestöber fehlte es dem Rindvieh dann doch ganz offensichtlich am sozialistischen Bewußtsein und sie erkrankten aus Protest. Trotzig gaben sie weniger Milch als geplant oder trugen sogar vorzeitig ihr Fell zu Markte.
Die Durchpeitscher der Rinderoffenställe ignorierten in ihrem Übereifer nicht nur die ablehnende Meinung der Bauern und die Warnungen anderer Fachleute (schließlich gab es bereits Hochschulen für Landwirtschaft), sondern sie übersahen auch, daß die heißen Steppen des Bruderlandes, aus denen die Bauweise stammte, nicht mit dem Klima in Mitteldeutschland zu vergleichen waren. Sie übersahen ebenfalls, daß in den Klimazonen der ruhmreichen UdSSR, die der mitteleuropäischen entsprachen, Kühe nach wie vor in ganz normalen Kolchose-Ställen behaglich vor sich hin- und wiederkäuten.
Zum nächsten Herbst hatte man die Offenställe im Rahmen des NAW wieder mit Wänden, Fenstern und Türen versehen, die überlebenden RVGE muhten zufrieden und die revolutionäre Idee wich betretenem Schweigen. Die Russenställe, wie sie allgemein hinter vorgehaltener Hand genannt wurden, verschwanden wieder in der Versenkung.
In Siersleben stand der erste Rinderoffenstall in der Nähe von Hornemanns Windmühle.
Kartoffeln im Quadrat
Aber – es kam noch ein weiterer Neuerervorschlag vom sozialistischen Bruder: Das Kartoffel-Quadratnest-Pflanzverfahren (sic!).
Ja, das war’s! Wenn die sowjetischen Kolchosbauern ihre Kartoffelerträge mit dieser Methode um 80% steigern konnten, dann müßten doch in der DDR mindestens 79% Ertragssteigerung machbar sein (mehr als 80% wäre politisch wohl nicht ratsam gewesen). Also, ab sofort war damit Schluß die Kartoffeln einfach in Reihen anzubauen.
Die neue Methode lehrte, daß zu den üblichen Reihen eines normalen Kartoffelschlages noch zusätzlich Querreihen im Winkel von neunzig Grad zu legen seien. Naseweise Bauern murmelten etwas von »Blödsinn« und »Russenquatsch«, aber das zeigte doch nur, daß sie die neue Zeit noch nicht verstanden hatten (2021: alte weiße Manner), denn schließlich rief es von allen Wänden: »Von der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen« und ich ergänze: »… auch auf dem Acker!«.
Solchermaßen belehrt, schwiegen die Genossenschaftsbauern und quälten sich in diesem Jahr bei der Pflege der Hackfrüchte nicht nur kreuz, sondern nun auch noch quer über den Schlag.
Endlich, im Herbst kam die Ernte, jetzt konnte man beweisen, wie klug man handelte. Damals wurden Kartoffeln mit dem Kartoffelroder aus der Erde geholt und mit der Hand gelesen. Beim Roden kam dann aber daß große Kopfkratzen: Rodete man keuz wurden die Querkartoffeln und beim Querroden wurden die Kreuzkartoffeln wieder unter die Erde gedrückt und überhaupt ging alles kreuz und quer durcheinander.
Im nächsten Frühjahr wurde die Kartoffelsaat wieder, wie seit den Tagen Friedrich des Großen, einfach in Reihen gesteckt.
Wurst am Stengel
Eine weitere Euphorie bezüglich revolutionärer Ackerbau-Methoden schwappte mit großem Propaganda-Aufwand durch die SED-Presse. Aus dem Land der ”Sieger der Geschichte”, die dortselbst am Kommunismus herumwerkelten, fand der Mais seinen Weg zu den lernbegierigen Genossen der DDR.
Mais, das war’s. Jetzt endlich würde es keine Fleischknappheit mehr geben. Jetzt entfällt sogar das Schlachten – endlich können Kühe und Schweine fressen, bis sie von allein platzen. Mais – das »Grüne Gold«, Mais – die »Goldperlen«, Mais – die »Goldstange« usw. Im Nachbardorf Hübitz, fanden in und vor der großen Scheune an der Verbindungsstraße, rsp. Mühlweg) Maisfeste mit Karussell und Preiskegeln und allem Rummelzubehör statt. Die RVGEs, die die Rinderoffenställe überlebt hatten, gebärdeten sich wie wild, wollten nur noch Mais fressen und rülpsten zufrieden in ihrer warmen, zugfreien Unterkunft. Es fand sich ein großer Dichter und ein noch größerer Komponist (vielleicht auch umgekehrt) und hervor quoll ein großartiges Opus: ein Maislied, das sofort im Musikunterricht gelehrt und gelernt und beim nächsten Fahnenappell frisch von jungen und zukunftsfrohen Pionieren gesungen wurde:
Der Mais, der Mais wie jeder weiß – das ist die Wurst am Stengel,
der Mais, der Mais wie jeder weiß – das ist ein strammer Bengel,
und wer den besten Mais anbaut – das ist ein kluger Mann,
weil er in die Zukunft schaut – und die fängt gerade an.
Ja der Mais, der Mais der schmeckt.
Feste feiern
Bekanntlich soll man feste feiern und auch Feste feiern, wie sie fallen. Familienfeiern waren immer, wie der Name schon sagt, feierlich – mindstens zu Beginn: Mutter hatte endlich mal die übliche Kittelschürze abgelegt und trug ein Kleid. Vater sah mit Schlips und Kragen aus, als wolle er zu Fleischauer zum Frühschoppen gehen. Ich trug weiße Knie- oder lange, braune Strümpfe, je nach Jahreszeit. Die Hosentaschen musste ich vorher immer ausleeren.
Für jede Feier wurde eine Köchin engagiert, die allerdings keine ausgebildete Köchin war, sondern sich im Dorf als Kochfrau für Feiern jeder Art besonders empfahl. In Siersleben gab es mehrere Kochfrauen, die immer mit einer frisch gestärkten, blütenweißen Schürze ihr Kommando antraten. Sie konnten Speisen kochen, die im Familienalltag niemals auf den Tisch kamen: Sago-Suppe mit Eierstich als Vorspeise zum Beispiel. Donnerwetter!
Silberne Hochzeit
Sehr gut kann ich mich an die Silberhochzeit meiner Eltern erinnern. Das war 1955. Vater und ich karrten mehrere Handwagen voller Bierkästen nach Hause, die in der Brunnenkammer neben Lauchstädter Mineralbrunnen, Malzbier, Limonade und Doppelkaramel aufgestapelt wurden. Im Keller standen zwei Fünfundzwanzig-Liter-Ballons mit Obstweinen, die bei uns zu Hause fast niemals auf Flaschen abgefüllt, sondern nach der Gärung im Ballon verblieben und im Keller aufbewahrt wurden. Der Keller war, wie an manchen Stellen im Dorf, ganz einfach mit dem Spaten aus Lehm herausgestochen worden und benötigte keine gemauerten Wände. Nur die Hausfundamente durfte man nicht untergraben – klar.
Neben Wein stand dort mindestens ein Dutzend Flaschen mit aromatisiertem Schachtschnaps bereit. Am Tag vor der Feier wurden die Gute Stube und das Schlafzimmer meiner Eltern ausgeräumt und mit geborgten Tischen und Stühlen zum Festsaal umgewidmet. Da zu einer Silberhochzeit nicht geladen wurde und auch nicht nur Verwandschaft willkommen war, war es nicht ganz einfach die passende Menge Speisen und Getränke zum Abfüttern bereitzuhalten. Es reichte immer. Für die passende Musik wurde der Dorfmusikus Schecke Elster engagiert, der fast jede Feier mit seinem Instrument begeigte.
Auf solchen Feiern wurden oft Späße verübt, die auch manchmal etwas derb waren; auf keinen Fall aber waren sie peinlich, wie man beim Weiterlesen etwa annehmen könnte. Ein zwar dröhnendes und doch herzliches Lachen. Lachen, aber kein Gejohle.
Zum Beispiel Hutbrummen: Drei oder vier Männer stellen sich gegenüber auf und beißen gleichzeitig in die Krempe eines Hutes. Sie summen eine Marschmelodie, die Schecke geigt. Alle gucken sich über den Hut hinweg an und tappen im Marschtakt kreisförmig umeinander. Das allein ist schon saukomisch anzusehen. Jetzt macht einer der Männer die anderen unter dem Hut nass – Das ist alles.
Waren meine Eltern zu Gast auf anderen Feiern, präparierte sich mein Vater manchmal mit einem Oberhemd, das von vorn gesehen Tip Top in Ordnung war. Auf dem Rücken jedoch war ein mit einem großen Schneiderbügeleisen hineingebranntes Loch zu sehen. Im Verlaufe der Feier mußte ein Eingeweihter unter irgend einem Vorwand die anwesenden Männer dazu veranlassen, das Jacket auszuziehen. Vater sträubte sich natürlich vehement, was den anderen befremdlich vorkam. Kam nach langem Sträuben dann doch endlich das Riesenloch zum Vorschein, war Stimmung unter dem Kronleuchter. Vater spielte den Ertappten und Mutter die Verlegene.
Ein anderer Sketch war der, daß Vater den Zigeunerbaron mimte, der an einem Kälberstrick ein Schwein führt. Das Schwein war meine Mutter, die unter einer übergeworfenen Wolldecke auf allen Vieren am Strick herumkroch und grunzte. Jetzt ging ein langes Palaver meines Vaters los, der einen Gast überzeugen mußte ihm das Schwein abzukaufen. War es verkauft (Kaufpreis ein Schnaps), bot Vater an, es auch gleich noch zu schlachten und tat das, indem er mit einem mitgeführten Holzhammer ausholte und dem Schwein vorn gegen die Rüsselnase schlug; das Schwein stürzte und war tot.
Wer das Spiel nicht kennt, erschreckt zunächst, der Hammer war groß und der Schlag nicht abgefedert. Hatte der Schrecken sich gelegt, zog Vater die Wolldecke weg und man sah ein dickes Federkissen und Scherben eines Blumentopfes herumliegen. Blumentopf und Kissen waren auf dem Kopf meiner Mutter einfach mit einem Bindfaden festgebunden und bildete, wenn sie den Kopf senkte, die Schnauze des Schweines. Mit großem Hallo wurde dann anschließend die Schweinehaut vertrunken.
Gern führte er auch folgenden Gag vor: Bei Tisch legte er wie beiläufig seinen linken Ringfinger an die Oberlippe direkt unter ein Nasenloch. Wer das nicht kannte, war verblüfft: Aus der Nase schaute nur das untere dritte Fingerglied; die anderen beiden Glieder schienen in der Nase zu stecken. Ein verblüffender Trick, dessen Auflösung sehr trivial war: an Vaters linkem Ringfinger gab es nur dieses eine Glied, die anderen beiden waren amputiert.
Ich erinnere mich ebenfalls noch an die, eine Injektion setzende, »Krankenschwester«, die unter viel Brimborium ihrem Mann , meinem Onkel, eine recht große Spritze mit langer Kanüle in dessen Hinterteil setzte, welches teilweise entblößt war. Die Spritze war natürlich nicht echt; die stumpfe Kanüle wurde beim Aufsetzen in den milchigen Zylinder der Spritze hineingeschoben, wie bei einem Theaterdolch.
Diese Art von Späßen mögen grob erscheinen, sie sind es auch, aber – so wurde es tradiert. Fast jeder Gast gab bei solchen Feiern eigene Schnurren und Gags zum Besten.
Jugendweihe
Neben der Silberhochzeit der Eltern war meine Jugendweihe im April 1959 die zweite große Familienfeier. Wie viele meines Jahrganges wollte ich nicht konfirmiert werden, obwohl ich gar nicht so recht wußte, warum. Ich sah den politischen Charakter dieser Inszenierung nicht. Sei es drum: Es war das erste Mal, daß ich im Mittelpunkt stand. Auch bei dieser Feier wurde aufgetischt, was Küche und Keller hergaben, und als ich im Morgengrauen wieder nach Hause kam, war immer noch kein Schluß. Ich kam aus dem Augsdorfer Freibad, wo wir ‑Jugendweihlinge und andere Kumpel- über den Zaun gestiegen waren und nicht wenig Unsinn anstellten.
Auf dem Weg dorthin hatten wir durch ein offenes Schlafzimmerfenster in der Teichstraße einen ganzen Pflaumenkuchen samt Kuchenblech aus einem Gestell gezogen. Das Blech fand Friseurmeister Unbehau, in der Mitte geknickt, morgens über dem Messingteller seines Ladens hängen. Weiter hatten wir ein, zwei Fensterläden ausgehoben, ein aus einem Schuppen ragendes Ofenrohr mit einem Stück Dachpappe und Rasenstücken abgedeckt und den Auslauf einer Pumpe am Dorfteich mit einem Oberhemd verstopft.
Kurzum, die Feier war gelungen und zwei, drei Tage später lag ich mit Fieber und Schüttelfrost im Bett. Eine halbe Aprilnacht mit nur einem Unterhemd unter dem Jacket war zu viel. Als ich nach etwa zwei Wochen wieder in der Schule auftauchte, war ich noch etwas blaß.
Die offizielle Jugendweihe-Feier fand im Saal bei Hermine statt und wir spulten unser seit Wochen geübtes Programm, bestehend aus Einmarsch, Auf-der-Bühne-stehen, Gelöbnis und Ausmarsch, ab. Wir bekamen eine der ersten Ausgaben des Buches ”Weltall – Erde – Mensch”, das ich ‑abgesehen von den üblichen politischen und ideologischen Aussagen- ganz interessant fand und das sich noch immer in meinem Besitz befindet. Es ist schon interessant, darin zu lesen, wie man sich vor einem halben Jahrhundert eine Mondlandung vorstellte. Keine Frage, die sowjetische Variante war erfolgversprechend und die amerikanische von vornherein zum Scheitern verurteilt. Nun ja.
Das Mansfeld Kombinat, auf dessem Brosowski-Schacht Vater arbeitete, richtete eine eigene zentrale Feier in Klostermansfeld mit Kaffee und Kuchen aus. Jeder erhielt als Geschenk fünf Bücher, die in einem Schuber überreicht wurden und auf dessen Rückseite eine vergoldete Inschrift angebracht war. Auch den Schuber samt Büchern besitze ich noch.
Die Geschenke, die ich zur Jugendweihe bekam, waren für damalige Verhältnisse üppig. Auf dem Dorf wurden gerne Taschen- und Handtücher verschenkt. Handtücher gab es für Mädchen und Bräute, während es für Jungen Taschentücher gab. So war es Brauch, so war es richtig. Eine besondere Art von Geschenk waren putzige Seifenkörbchen: Ein handbesticktes Damentaschentuch wurde kunstvoll um ein Stück Seife drapiert und mit achthundertundvier Stecknadeln so an der Seife festgesteckt, daß sie wie ein Tausenfüßler auf den bunten Glasköpfen stand. Seeehr hübsch. Und so kam es, daß das Gros der Geschenke Taschentücher ausmachten, von denen heute, 60 Jahre später, immer noch ein drei Meter hoher Stapel in meinem Schrank liegt; ein Geschenk fürs Leben. Weiter bekam ich zwei Paar Manschettenknöpfe und das Reise-Nessecaire benötigte ich erst, als ich 1964 zur NVA eingezogen wurde. Der Inhaber der Dorfdrogerie ließ eine 200-Milliliter-Flasche ”Herbacin-Schuppen-Haarwasser” überbringen usw.
Das begehrteste dieser Geschenke jedoch war Bargeld, von dem ich unglaubliche vierhundert Mark erhielt; das Monatseinkommen eines Lehrers. Von diesem vielen Geld kaufte ich mir endlich ein neues Fahrrad im Eislebener Großen HO – ein Diamant-Sportrad. Mein altes Fahrrad war in sämtlichen Einzelteilen aus Resten anderer Räder, die ich auf der Asche fand, zusammengeflickt: Speichen, Lager, Schrauben – alles gehörte mindestens schon einmal zu einem Fahrrad. Das Geld reichte auch noch für ein kleines Zelt und seitdem war ich an sehr vielen Wochenenden und Ferientagen mit Rad und Zelt und ein oder zwei Kumpeln unterwegs – zumeist im Harz. Dieses Rad benutze ich noch bis 2019. Und man muß lange schauen, um solch ein großartiges Fahrrad mit einem derart grazilen Rahmen zu finden.
Trockener & Nasser
Hausgebackener Kuchen war auf dem Dorf eine Selbstverständlichkeit. Zu jedem Anlaß, gleichgültig, ob freudig oder traurig, wurde Kuchen gebacken. Richtiger: Man ließ backen. Zu Hause wurden lediglich Eier zerschlagen, Butter verrührt, Zucker dazwischengekrümelt, aromatische Sachen hineingetan, gerührt, gerollt und geschlagen, Salz vergessen und irgendwann war der Teig so weit, um auf den großen, sorgfältig gefetteten Kuchenblechen seinem Endstadium entgegenzureifen.
Die Hausfrauen setzten sich die großen Backbleche auf ihre Hüften und trugen sie in eine Bäckerei. War es ein kirchlicher Feiertag, kam es schon mal vor, daß sich eine bis zum Horizont reichende Kette blechtragender Hausfrauen bildete. In der Backstube standen Gestelle auf Rollen, in die die Kuchenbleche geschoben wurden, und damit keine Verwechslungen auftraten, steckten in jedem Teig kleine Namensschildchen. Da eine Hausfrau meist nur zwei Hüften hat, war es für sie unumgänglich, den Weg zur Backmeisterei mehrmals zu gehen; eine richtige Feier benötigte schon mal etliche Quadratmeter Kuchen. Nach erfolgter Ablieferung in der Backstube oblag es nun dem Brot-und Kuchenmeister die Bleche für seine Kunden in den Backofen zu schieben.
Damals wurde der Backofen noch mit Kohle und Holz beheizt. Wenn das Brenngut verbrannt war, wurde die Asche aus dem Backraum seitlich herausgestoßen und ein an einer Holzstange befestigter nasser Mehlsack durch den Backraum geschleudert, um letzte Aschereste zu entfernen. Trotzdem kam es immer wieder vor, daß an der Unterseite von Brotlaiben kleine Aschereste eingebacken waren, was aber niemanden störte; es gehörte einfach dazu; mit dem Fingernagel wurde es herausgeknipst – fertig. Geriet trotzdem mal etwas zwischen die Zähne, dann knirschte es gewaltig. Beim Backen von Blechkuchen war dieses Asche-Problem naturgemäß uninteressant.
Nach einigen Stunden wurden die fertig gebackenen Kuchen wieder abgeholt. Die Nachbarn hinter den Gardinen zählten genau, wieviel nasse und trockene Kuchen ins Haus getragen wurden; Nasse waren Obst‑, Quark- und Mohnkuchen, während zu den Trockenen Streusel‑, Schokoladen- oder Zuckerkuchen zählten. Nasse Kuchen wurden nach Mansfelder Tadition generell mit Solf belegt – das ist dieses Eierschnee-Butter-Milch-Gries-Vanille-Zucker-und-was-weiß-ich-Gemisch, das in vergröberter Rezeptur anderswo als Eierschecke nicht im entferntesten so gut schmeckt.
Sand- und Marmorkuchen sowie Böden für Torten und ähnliches wurden zu Hause in die Röhre geschoben. Damit konnte das Fest beginnen.
Übermittelten Bekannte und Nachbarn Glückwünsche, Geschenke bzw. Trauerbekundungen, gab es als Gegenleistung ein Stück Kuchen, dessen Menge bei der Vorbereitung des Festes bereits mitkalkuliert wurde.
Die Menge und die Art des Kuchens sagte etwas aus über die Güte der beiderseitigen Beziehung: Viel und nass – eine sehr gute Beziehung, wenig und trocken – miserable Beziehung. Eine weitere Differenzierung erfogte durch die Anzahl und Qualität mitgegebener Randstücke.
Also – ein einziges kleines Randstück Streuselkuchen (eventuell noch leicht angebrannt) hieß nach diesem Code: Du mich auch und ein ansehnliches randloses Stück Sauerkirsche deutete auf Freundschaft hin. Über Jahrzehnte wurde peinlichst genau Buch geführt, wer wann was gegeben bzw. erhalten hat. Mit Kuchen zahlte man heim.
Weihnachten
Vor dem Ersten Advent wurden die Wecken gebacken, die wir niemals als Stollen bezeichneten. Mutter buk immer vier Stück, zu je etwa sechs Pfund. Mein Bruder in Cuxhaven erhielt seine eigenen sechs Pfund.
Wie beim Schlachtefest gab es beim Wecken-Backen immer Probleme mit den Gewürzen, insbesondere Zitronat und Rosinen. Auch Mohn war sehr schlecht zu erhalten und Butter mußte zu teuren HO-Preisen hinzugekauft werden. Die Bäcker des Dorfes (Samtleben, Dönitz, Höcke, Panier, Saray) legten in der Weihnachtszeit Extra-Backtage für Wecken ein. Weihnachten wurde die Gute Stube geheizt, die man nur betrat, um durch sie hindurch in das Schlafzimmer der Eltern zu gelangen – zumindest, bis der Fernseher anfing, die Gute Stube zu ruinieren. Vater schmückte den Baum, bohrte mit dem Nagelbohrer Loch an Loch, um mit eingesteckten Zweiglein, den Baum zu »verschönern«. Er kostete ständig, ob der selbstgefertigte Likör die richtige Temperatur hatte. Daneben waren noch zu überprüfen: der Geschmack, die Konsistenz, die Farbe, der Zuckergehalt, nochmal Temperatur usw …
Immer in der Weihnachtszeit stand ein eingestaubter Halbmeter-Weihnachtsmann in einem rotlackierten Pappmachee-Mantel und Wackelkopf im Schaufenster bei Kunze, der alles mögliche verkaufte: Garne, Knöpfe, Vasen, Geschirr und Spielwaren. Er, der Weihnachtsmann, nickte freundlich lächelnd zwischen Unmengen Spielzeuges vier Wochen lang durch die Scheibe. Eines Tages war ich wie elektrisiert: Es stand ein knallrot lackiertes Feuerwehr-Holzauto im Fenster. Auf dem Dach hatte es eine gelbe Leiter, die aufgestellt, gedreht und ‑das war unglaublich- auch noch mit einer kleinen Handkurbel ausgefahren werden konnte. Aber das war noch nicht alles, die Mannschafts-Kabinen- und die Fahrerhaustüren konnten geöffnet werden und man sah gelbe Holzsitze und ein gelbes Lenkrad. Auch der Fahrzeugkoffer – überall Türen und Klappen, hinter denen unter anderem zwei gelbe, drehbare Schlauchtrommeln zum Vorschein kamen. Wahnsinn..! Ich muß wohl ziemlich genervt haben: Am Heiligen Abend stand das Feuerwehrauto unter dem Baum.
Zusammen mit meinem Freund Dieter saßen wir ‑lange nach Weihnachten- auf dem Fußboden bei mir zu Hause und spielten mit meiner gelb-roten Feuerwehr. Damit alles etwas realistischer wirkte, beschloß Dieter ein kleines Wäscheklammern-Feuer, ein Knäckerchen, zu entfachen. Die Feuerwehr rückte vom Nachbarzimmer her aus. Aber statt zu löschen, nahm sie Schaden, dergestalt, daß sie beinahe samt unserer Wohnungseinrichtung verbrannte. Wenn ich nicht nach meiner Mutter gebrüllt hätte, die mit einem Eimer von der Wasserbank die Löschaktion in ihre Hände nahm, hätten nicht nur unser beider Backen gebrannt.
Und genau an dieses Feuerwehrauto konnte sich bei einem Klassentreffen fünfzig lange Jahre später auch meine damalige Klassenkameradin Elke, die Tochter des Spiel- und Kurzwarenladen-Inhabers, erinnern und zwar deshalb, weil von der ausgefahrenen Feuerwehrleiter Rapunzel ihren Kletterzopf fallen ließ, an dem der unten stehende Prinz die ganze lange Adventszeit hindurch nicht hinaufzusteigen vermochte; beide Puppen waren nämlich i h r Weihnachtswunsch.
Ein anderes Mal erhielt ich zu Weihnachten ein kleines Riesenrad, an das Vater die Zink-Druckguß-Felge eines Kinderwagens montiert hatte. Über diese Felge lief ein Bindfaden zu einem primitiven Getriebe, das aus einigen Holzrädern und einem zweiten Kinderwagenrad bestand. Dieses Getriebe trieb ein kleines Hammerwerk an, dessen Hämmer über je einer Schüttrutsche angebracht waren. Schüttete man durch einen, auf dem Dach befindlichen, Einfülltrichter etwas hinein, kam es auf den beiden Schüttrutschen genauso wieder heraus – egal ob die Hämmer arbeiteten oder nicht.
Das Alles wurde von einem kleinen Elektromotor angetrieben, der einem Flugzeugwrack entnommen worden war. Elektromeister Bellmann ‑später jahrelang Bürgermeister von Siersleben- wickelte einen Transformator für den Motor, Vater umhüllte das Ganze mit einem lindgrün lackierten Holzkasten, setzte Getriebe, Hammerwerk und Zwergen-Riesenrad auf ein bunt lackiertes Holzbrett. Fertig. Bis auf das blanke Riesenrad mit seinen Gondeln, hat er alles selbst angefertigt.
Mit diesem Ding spielte ich stundenlang – die Steuerung des in mehreren Stufen regelbaren, links- und rechtslaufenden Motors, faszinierte mich. Als irgendwann noch ein Stabilbaukasten hinzukam, flirrten Räder und Seilscheiben, hasteten Pleuel und drehten sich Haspeln um so mehr. Eines Tages aber heulte mein Motor, sich mit halber Lichtgeschwindigkeit drehend, auf und qualmte und stank. Schluß. Ich hatte die Umstellung der Elektroversorgung von 110 auf 220 Volt Spannung vergessen, nicht beachtet, nicht ernst genommen – wer weiß.
Die Schächte des Mansfelder Reviers veranstalteten für die Kinder ihrer Belegschaft immer zentrale Weihnachtsfeiern. Nach einigen Liedern und Gedichten gab es Wecke und Malzkaffee. Es schlossen sich dann einige Quiz- oder Spielrunden an, bei denen man noch etwas gewinnen konnte.
Bei einer Spielrunde war folgendes schnell und dreimal fehlerfrei zu sprechen: ”Der sowjetische Sputnik triumphiert über den amerikanischen Kaputtnik.« Ich muß gestehen, daß ich der Sieger dieses Schnellsprech-Wettbewerbes war. Hhmm. Im Bücherschrank steht heute immer noch ”Giuseppe und Maria”.
Tag des Bergmanns
Jedes Jahr am ersten Sonntag im Juli wurde in der DDR der »Tag des Bergmanns« begangen. Obwohl im Namen nicht explizit mitgenannt, waren selbstverständlich auch die Hüttenleute in die Ehrungen und Feierlichkeiten mit einbezogen. Im Vorfeld dieses Tages wurde dafür gesorgt, daß die Geschäfte eine Woche zuvor und eine Woche danach mit Waren vollgestopft waren. Vor allem Industriegüter waren es, die in dieser Zeit eingekauft werden konnten, wie zum Beispiel TV-Geräte und Radios. Aus diesen Sonderkontingenten des Einzelhandels stammten mein erstes Kofferradio (gekauft Juli 1960), mein Diamant-Sportrad und mein Zweimannzelt samt Spirituskocher (gekauft Juli 1959).
Aus Anlass dieses Feiertages wurden jede Menge Geldprämien in nicht unbeträchtlicher Höhe und weitere Auszeichnungen ‑ebenfalls mit Geldzuwendungen verbunden- an die Belegschaften der Kombinatsbetriebe ausgeschüttet.
Extra für diesen Feiertag wurden, vor dessen erster Begehung, neue Uniformen für die Berg- und Hüttenleute entworfen, die auch gern von ihnen getragen wurden und in denen sich nicht Wenige, so auch mein Vater, für ihre Letzte Fahrt auf den Weg machten.
So kurz nach dem Kriege wurde uns immer wieder erklärt, warum es wichtig sei zuerst die Schwerindustrie wieder aufzubauen und erst danach die Leicht- , also in erster Linie die Konsumgüterindustrie. Zwar kam dann noch einmal die Chemieindustrie dazwischen (Chemie bringt Brot, Wohlstand Schönheit), aber dann, in den 70ern unter Honnecker, legte auch die Konsumgüterindustrie etwas zu – wenn auch nur für sehr begrenzte Zeit.
Und so war Wilhelm Piecks Spruch »Ich bin Bergmann – wer ist mehr« nicht zufällig eine wirksame Motivation der Beschäftigten in der Montan- und Hüttenindustrie. Die Mansfelder Berg- und Hüttenleute waren wirklich stolz auf sich und ihre Arbeit und auf ihre Uniformen.
Am Festtag selbst wurde früh um sechs Uhr durch den Spielmannszug ein Wecken durchgeführt, d.h. er marschierte mit klingendem Spiel durch Siersleben und spielte das übliche Repertoire. Vor den Wohnhäusern der Honoratioren des Dorfes wurde kurz angehalten und ein Ständchen dargebracht.
Nach dem Frühstück ging es auf die beiden zentralen Festplätze; der des Thälmannschachtes befand sich in Klostermansfeld und der Festplatz des Brosowskischachtes war in Gerbstedt. Darüberhinaus waren in fast jedem Dorf noch lokale Festplätze eingerichtet. Schießbude, Karussell, ein nachgebauter Stollen mit echten Preßlufthämmern, Seilbahn, Losbude – alles da. Man konnte Getränke- und Verzehrbons oder auch Warengutscheine, die ebenfalls alle in Vorbereitung dieses Tages verteilt wurden, einlösen. Zur musikalischen Unterhaltung spielten Blasorchester und wenn »Glück Auf – Der Steiger kommt« gespielt wurde, sangen ausnahmslos alle mit. Ohne zu gröhlen. Am Abend war auf allen Sälen Tanz und dann kam es natürlich auch vor, daß man nicht mehr deutlich artikulieren konnte oder die Füße eine andere als die beabsichtigte Richtung einschlugen. An diese Feiertage habe ich nur die besten Erinnerungen.
Eislebener Wiese
Maienaustragen
Silvestersingen
Splitter
Tri Tra Trallala
In Dittmars Saal herrschte Hochstimmung, wenn Kasper mit seiner Papp-Klatsche Gretel gegen das Krokodil verteidigte und wenn das Krokodil den Teufel in die Nase biss und der Schutzmann für Ordnung sorgte. Wir neuen, kleinen Menschen brüllten mit hochroten Köpfen Kasper zu, sich doch endlich umzudrehen, weil das Krokodil ihn sonst auffrißt – und der versteht einfach nichts! Wir standen, mit unseren drei bis fünf Jahren, kurz vor einem Herzkasper. Eine kleine Puppenspieler- und Schaustellerfamilie aus Eisleben war über Jahre hinweg ziemlich regelmäßig in Siersleben zu Gast und führte ihre Stücke auf. Man konnte gut verfolgen, wie es ihr materiell immer besser ging. Ließen sie anfangs in Dittmars Saal ihre Puppen noch hinter einer über einer Wäscheleine hängenden Decke tanzen, kamen sie bald darauf mit einem eigenen Zelt. Vor dem Zelt stand ein Stuhl mit einem Plattenspieler, der einen schmissigen Marsch über den Dorfteich spuckte. Der Impresario höchstselbst rührte die Kleine Trommel, das heißt, daß er die Marschmusik mit Trommelschlag etwas aufhübschte.
Beim nächsten Mal konnten sie einen neuen, kleinen, rot-weißen Zaun um ein viel bunteres Zelt aufbauen und zusätzlich noch ein Kinderkarussell daneben stellen. Dieses wurde von uns Dorfjungen von einer Plattform aus freiwillig gedreht, indem wir wie Dreschochsen im Kreis liefen, die Speichenkonstruktion des Drehwerkes vor uns herschiebend.
Wiederum ein Jahr später hatte das Karussell einen Elektromotor und teilte sich den Platz am Dorfteich mit einer zusätzlichen Luftschaukel. Irgendwann war alles vertreten, was bunt, schrill, glitzernd war und sich drehte. So wuchs über die Jahre eine Rummel-Tradition heran und der Teichplatz war bei solchem Spektakel der Treffpunkt des halben Dorfes.
Rübermachen en gros
Meine gesamte Schulzeit hindurch, die sich bis Juli 1961 erstreckte, begleitete mich das »Rübermachen« von Schulfreunden mit ihren Eltern, Nachbarn, Bekannten. Jeden Morgen stellte sich immer die spannende Frage, wessen Platz in der Schulklasse ab heute leer bleiben würde. Besonders interessant wurde es, wenn ein Lehrer sich entschloß, sich im anderen Teil Deutschlands niederzulassen. Sogar ein Schuldirektor war unter diesen ”vaterlandslosen Gesellen”, wie sie von linientreuen Genossen bezeichnet wurden.
Auch einige kleine Geschäftsleute verließen in dieser Zeit ebenfalls unser Dorf in Richtung Westdeutschland. Darunter befanden sich der Inhaber des Spiel‑, Glas- und Kurzwarenladens, ein Apotheker, ein Bäckermeister, ein Fleischermeister und Gastwirt, der Inhaber eines Möbelgeschäftes und Andere. Auch Klein- und Mittelbauern, die im Zuge der Bodenreform nicht enteignet wurden, gingen nach dem Westen. Der Druck, in die sich gerade in Gründung befindliche LPG einzutreten, wurde größer. Einige ließen ihre jahrhundertealten Betriebe über Nacht im Stich.
Ich erinnere mich, wie wir, siebzehnjährig, auf unsere Fahrräder gestützt mitten auf dem damals absolut autofreien Dorfplatz standen und über die gestern in Berlin entstandene Mauer redeten, die genau das bremsen sollte. Die politische Dimension erfaßten wir damals nicht einmal ansatzweise. Die Nachrichtenlage war schwierig, da das Fernsehen noch äußerst spärlich verbreitet war und Nachrichtensendungen des Westradios grundsätzlich gestört wurden.
Einige Tage später erzählte mir E. im Vertrauen, dass sein Vater die komplette Wohnungseinrichtung verkauft hatte. Die Familie entschloss sich einen Tag zu spät zum Rübermachen.
Flüchtlinge vs.Umsiedler
Die im Stich gelassenen Höfe der Kleinbauern sowie die Höfe der bereits im Zuge der Bodenreform enteigneten Großbauern wurden von Neubauern bewirtschaftet. Diese waren Kriegsflüchtlinge, in der DDR beschönigend als Umsiedler bezeichnet.
Einige Dutzend Flüchtlingsfamilien blieben auch in Siersleben hängen. Für sie wurde eine ganze Siedlung von Reihenhäusern in kürzester Zeit aus dem Boden gestampft. Aufgrund mangelnder Baumaterialien wurden die Häuser in Lehmbauweise aufgeführt, weshalb die Siedlung damals umgangssprachlich als Lehmdorf ‑ohne die spätere negative Konnotation- bezeichnet wurde und dessen Häuser heute (2021) sehr begehrt sind.
Der damalige Sportplatz, besser Fußballplatz, in der Steinhöhe war dieser Siedlung im Wege und so wurde dieser im Rahmen des Nationalen Aufbauwerkes (NAW) an das östliche Dorfende zwischen Neue Straße und Ristebach verlegt.
Die meisten Flüchtlinge konnten in den neuen Siedlungshäusern mit den winzigen Wohnungen untergebracht werden. Einige Familien aber lebten irgendwo im Dorf ‑besonders in den sogenannten Schlaf- und Familienhäusern- oft in nur einem Raum, manchmal sogar ohne Küche. Ihre Wohnungseinrichtungen waren teils Spenden von Dorfbewohnern, teils wurden sie von der Gemeinde dem Möbelfundus geflüchteter Einwohner entnommen und verteilt. An Bad oder Innentoilette war nicht zu denken; auch die neu gebauten Siedlungshäuser waren damit nicht ausgestattet. Hier befanden sich die Toiletten sogar auf der grünen Wiese hinter den Wohnhäusern, so daß neugierige Bewohner Strichlisten über die Stuhlfrequenz ihrer Nachbarn hätten führen können.
Kamen die Umsiedler aus den schlesischen Bergbaurevieren, so fanden sie schnell Arbeit im Mansfelder Kupferrevier. Unter den Flüchtlingen befindliche Tagelöhner, Knechte und Kleinbauern erhielten, wenn sie wollten, eine Neubauern-Hofstelle. Aus welchen Gründen auch immer wurde mancher Flüchtling Neubauer, obwohl er kaum in der Lage war, einen Hof zu bewirtschaften. Besonders schwer hatten es diejenigen Frauen, die ohne männlichen Ernährer hier strandeten; es gab viele von ihnen, die auf den Kläuberställen der Schächte ihr Brot mühsam verdienten.
Unter den Umsiedlern gab es selbstverständlich auch Lehrer, Akademiker, Geschäftsinhaber und andere Stände, die in ihrer alten Heimat hochgeachtet waren und hier, in einem kleinen Vorharz-Dorf, nicht nur ein Nichts waren, sondern darüber hinaus auch noch von manchem Alteingesessenen angefeindet wurden. Da gab es mitunter böses Blut.
Wir Kinder allerdings hatten keine derartigen Animositäten auszutragen; mehr als die Hälfte meiner Schulfreunde waren Umsiedlerkinder und sie waren wunderbare Freunde. Sie kamen überwiegend aus dem Hauerland, aus Schlesien, Böhmen, Breslau … Hallo, Hansi!
Speiseeis
Irgendwann hatte Bäcker Samtleben entdeckt, daß man mit Speiseeis eine große Bedürfnislücke decken konnte. Kurzerhand durchlöcherte er seine Hauswand und setzte ein Fenster ein, durch welches er nun sein Eis verkaufen konnte – eine kleine Kugel plus Spitztüte für zehn und eine große Kugel plus Waffelbecherchen für zwanzig Pfennig. Jeder weitere Betrag war möglich und man erhielt den Gegenwert dann zwischen Shellmuscheln aus Waffelteig.
Eine Zeitlang erschien ein Eisverkäufer, der aus Gerbstedt kommend, mit seinem Beiwagenkrad die Dörfer abfuhr. Große Isolierbehälter, die er in seinem Beiwagen mit Stricken verzurrt hatte, enthielten die Köstlichkeiten. Der Gerbstedter Eismann verkaufte sein Erzeugnis immer auf der Einmündung Steinhöhe / Lindenstraße vor Schmied Frankes kleiner Werkstatt.
Rübenmonster
Bereits sechzig Jahre bevor die heutige Immerschlaue Journaille naseweis behauptete, die Amis hätten Halloween nach Deutschland gebracht, haben wir als Kinder dies bereits gefeiert. Wir wussten allerdings noch nicht, dass es einmal so genannt werden und sich obendrein als gigantischer Werbetrick herausstellen würde. Immer im November, wenn die Rübenkampagnen auf Hochtouren liefen, höhlten wir große Futterrüben aus und schnitten Gesichter hinein, um abends brennende Kerzen darin unterzubringen. Der Krautschopf wurde gerade abgeschnitten und seitlich mit einem Loch versehen, durch das die Hitze abziehen konnte. Diese Gruselrüben stellten wir dann auf Fensterbänke ‑vorzugsweise bei alten Menschen- in der irrigen Annahme kindlicher Freude, daß diese sich gehörig erschrecken…
Heute könnte man sagen, daß die Futterrüben nur eine Ersatzlösung war, normalerweise hätte es ein Kürbis sein müssen. Kürbisse aber waren ein Lebensmittel – und damit spielte man nicht. Daran hielt man sich.
Mein 17. Juni 1953
An den 17. Juni 1953 habe ich persönlich leider nur noch einige ‑wenig kontrast- und konturenarme- Erinnerungen. Das, was einigermaßen deutlich im Gedächtnis blieb, ist, daß russische Soldaten mich daran hinderten meinen Vater von seiner Arbeitsstelle abzuholen, wie ich es schon oft getan hatte. Vater arbeitete auf dem Brosowski-Schacht, der erst seit etwa einem Jahr seinen neuen Namen trug und vorher über Jahrzehnte der Paul-Schacht war.
Ich war, wie immer, mit dem Fahrrad dorhin unterwegs. Um zwei Uhr nachmittags war Schichtschluß und gegen Drei war mein Vater normalerweise immer zu Hause. Also, mag es gegen 14:30 gewesen sein, als ich voller Neugier langsam auf einen mitten auf der Straße zwischen Siersleben und Schacht stehenden Militärlastwagen zufuhr, der die Straße blockierte. Beidseits der Straße, in Höhe des Fahrzeuges, lagen Russen im Gras, qualmten ihre Papyrossy und ‑ich schwöre es- aßen urdeutsche Bismarckheringe aus ihren ölschwarzen Pfoten.
Einer der Russkis erhob sich bei meinem Näherkommen und stellte sich mir breitbeinig in den Weg. Da ich mich nicht traute, ihn mit meinem Fahrrad totzufahren, bremste ich 10 Meter vor ihm ab.
Was sollte ich, knapp 9‑jährig, tun? – unbedingt den Soldaten gnädig stimmen! Wie hieß doch gleich das Gedicht aus meinem Lesebuch über den großen Stalin? Im Kreml brennt noch Licht? Ja! – aber das kannte ich noch gar nicht.
Sollte ich lieber »Freundschaft« rufen oder »Frieden«?- das Dumme war nur – Russisch-Unterricht gab es erst ab der fünften Klasse und ich war in der Zweiten. So rief ich verzweifelt das einzige russische Wort, das jeder im Land kannte: »Iwan!« und lächelte vorsichtshalber.
Ein Russenstiefel stampfte drohend auf und nach vorn. Gleich frisst er mich – doch ich hörte so etwas wie nix farren chier und dawei, zuchuck und seine am ausgestreckten Arm hängende Hand winkte rückwärts. Eingeschüchtert fuhr ich vielleicht hundert Meter zurück, setzte mich ins Gras und wartete. An diesem Tag bekam ich meinen Vater aber nicht mehr zu Gesicht. Erst am nächsten Tag saß er wieder um Drei am Mittagstisch.
Mehr zum 17. Juni 1953 hier auf dieser weiteren Seite
Wird sporadisch ergänzt und fortgesetzt; siehe auch meine Dorfgeschichten aus der gleichen Zeit





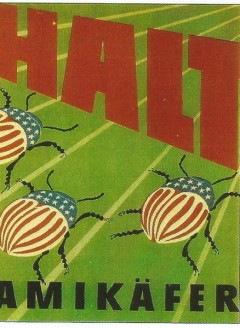












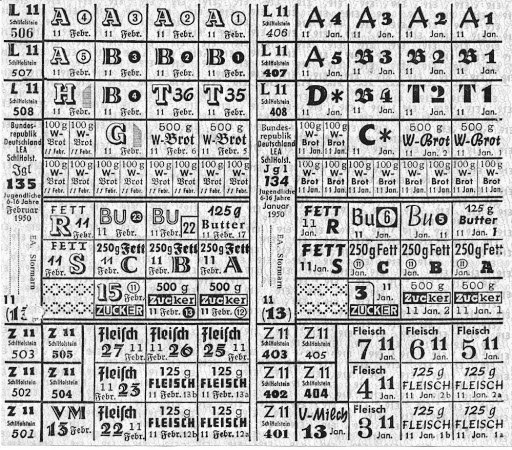



Hallo Horst,
ich bin einfach nur begeistert von den „50ern“ und möchte dir sagen, dies ist sooo gut geschrieben, einfach nur Spitze! Ich fühlte mich in diese Zeit „versetzt“ und habe alles ringsumher vergessen!
Immer nur weiterlesen, weiterlesen…
Ich erinnere mich nun auch an Elke Kunze (bei der ich öfters zum Spielen war), die dann auf einmal nicht mehr da war, od. an Sigrid Leye, die in der Steinhöhe wohnte.
Wie erwähnt – so spannend – große Klasse, lieber Horst.
Gruß Gitta Steckbauer (geb. Minnich)